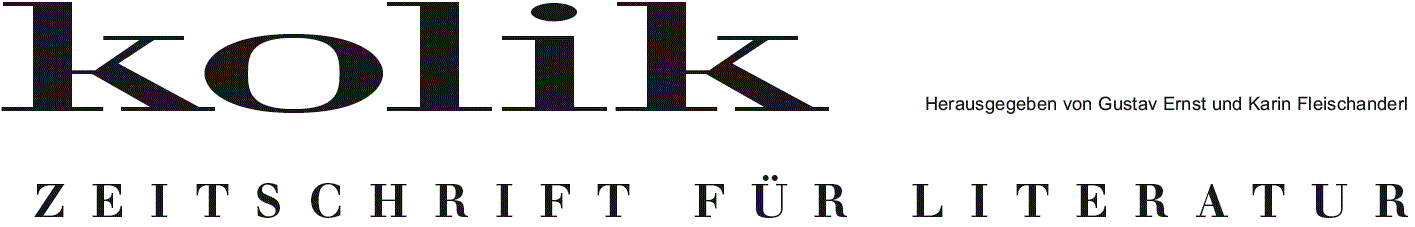Karin Fleischanderl
Der Tod bin ich
Zur Literatur Elfriede Jelineks
„Die Klavierspielerin“ als Ausgangspunkt: Eine Situation, in der alle Unterschiede soweit wie möglich aufgehoben sind: Die „Damen Kohut“, Mutter und Tochter, leben in einer Art Ehe zusammen, der Geschlechter- und Altersunterschied werden geleugnet. Der Vater hat den beiden den Gefallen erwiesen, frühzeitig auf dem Steinhof verdämmert zu sein, Mutter und Tochter schlafen im selben Bett, als gäbe es keine Zeit, keine Trennungen und keine Männer. Walter Klemmer bricht kurz in die Idylle ein, wird jedoch augenblicklich entfernt, so wie man sich ein lästiges Staubkorn aus dem Auge wischt. Das Auge tränt danach ein bißchen, aber das war’s auch schon. Den beiden Damen (und mit ihnen der erzählenden Instanz) ist der Wunsch anzumerken, alles beim alten zu lassen beziehungsweise noch einen Schritt weiter vom Leben zum Tod, von der Bewegung zum Stillstand zu gehen. Im Eingangssatz stürzt die Klavierlehrerin – ein ältliches Kind oder eine kindische Erwachsene – immerhin noch „wie ein Wirbelwind“ in die Wohnung, die sie mit ihrer Mutter teilt, im letzten Satz kehrt sie in ihr Gefängnis zurück: „Sie geht und beschleunigt langsam ihren Schritt“. Walter Klemmer ist es zwar gelungen, die beiden Damen etwas aufzumischen, doch letztendlich haben sie ihr Reich erfolgreich verteidigt, für das Elfriede Jelinek Metaphern aus dem Bereich des Drecks, des Verfalls und der Verwesung findet: Die Wohnung ist ein „Schweinestall, der langsam verfällt“, eine „Falle“, ein „graues und grausames Land der Mutterliebe“.
Dem Mainstream der Jelinek-Kritik zufolge entspräche die Hermetik der Handlung ausweglosen kleinbürgerlichen Verhältnissen: „Von der ersten Seite der Erzählung an weiß man, daß sich hier eigentlich nichts entwickeln kann, daß das Geschehen in sich selber kreisen wird. Die Figuren agieren wie Fliegen unter einer Glasglocke, deren durchsichtige Wand sie aufprallen läßt und zurückwirft … Die Klassenschranken des Kleinbürgertums sind ebenso transparent wie undurchdringlich, ihre Unsichtbarkeit gibt den in ihnen Eingeschlossenen den Blick frei auf eine Welt, die sie für die ihre halten, und die für sie unerreichbar bleibt“.1 Andererseits ist der Hang zum Negativen, zum spöttischen Sarkasmus, zur „Wirklichkeitsdeformation“ immer wieder als Charakteristikum der österreichischen Literatur beschrieben worden, von Claudio Magris2, der in der Statik der beschriebenen Verhältnisse und der rückwärtsgewandten Utopie den Versuch sieht, die geordneten Verhältnisse der Donaumonarchie wiederaufleben zu lassen, als auch von Robert Menasse3, der die Scheinharmonie sozialpartnerschaftlicher Verhältnisse für die Idyllen in der österreichischen Literatur verantwortlich macht. Einmal abgesehen davon, daß Literatur zweifellos mehr kann und will, als ein Spiegelbild gesellschaftlicher Verhältnisse zu sein, sind in Elfriede Jelineks Literatur beide Positionen vorhanden: einerseits die Kritik an Österreich, am latent Faschistischen im „Land der Musik und der weißen Pferde“, an festgefahrenen Geschlechterrollen etc., andererseits ein obsessiver Hang zur (negativen) Idylle, zur Heraufbeschwörung statischer, faszinierend unerträglicher Verhältnisse. Statik und Hermetik sind ja nicht nur bezeichnend für „Die Klavierspielerin“, sondern ziehen sich als roter Faden durch das gesamte Werk Elfriede Jelineks, von den frühesten Arbeiten bis zum Roman „Gier“, in dem die Beschreibung eines Baggersees über den Umweg der Darstellung der kaputten Natur zum schaurig-schönen Stilleben, zur nature morte gerät.
Elfriede Jelineks Literatur ist großteils satirisch, parodistisch, zynisch, ihre Texte operieren mit Auslassung und Verzerrung. George Orwell schrieb über den Satiriker Swift: „Bei seinem ewigen Herumreiten auf Krankheit, Schmutz und Entstellung erfindet Swift eigentlich nichts, er läßt nur etwas aus. Auch das menschliche Verhalten, besonders in der Politik, ist so, wie er es schildert, wenngleich es noch andere, wichtigere Faktoren enthält, die er nicht sehen will … Swift besaß keine Weisheit im üblichen Sinne, aber er besaß eine ungeheuer intensive visionäre Kraft, mit der er eine einzelne verborgene Wahrheit herausgreifen und sie dann vergrößern und verzerren konnte.“4
Auch Elfriede Jelinek läßt aus, verzerrt und vergrößert: Diese muffigen 50er-Jahre-Zustände, diese analen Idyllen, wo Dreck, Verfall und Verwesung herrschen und in denen Nazitum und Deutschtümelei ihre Fortsetzung finden, sind zweifellos nicht unsere ausschließliche Realität, was Elfriede Jelinek von einer (zumeist konservativen) Kritik auch immer wieder vorgeworfen worden ist. Wo bleibt das Positive, fragte zum Beispiel Iris Radisch im Literarischen Quartett anläßlich der Besprechung von „Gier“.
Das Positive entstünde demnach, der klassischen Definition der Satire zufolge, im Kopf des Lesers: „Kein Text, der nicht Zeugnis davon gäbe, daß seine Darstellung um der realen Herstellung seines Gegenteils da ist. Satire ist auf Aufhebung ihrer selbst aus …“5
Andererseits ließe sich Elfriede Jelineks Literatur leicht mit rezenten Theorien „erledigen“. Der postulierte „Tod des Autors“, der Verzicht auf außerliterarische Referenz, gestattet, Elfriede Jelineks Literatur als frei flottierende Textflächen, als beliebiges Spiel der Bedeutungen zu sehen, wozu auch die Autorin selbst mit ihren Kommentaren immer wieder beigetragen hat: „Ohne sich um die Wirklichkeit zu kümmern, wird der Effekt zur Realität“.6 Elfriede Jelinek als postmoderne Autorin? Doch einmal abgesehen davon, daß literarische Sprache der Aufklärungsabsicht literaturwissenschaftlicher Methoden überhaupt nicht befriedigend zu unterwerfen ist7, die auf dem Rücken der Autoren doch nur die Schlüssigkeit und Stimmigkeit des eigenen Gebäudes unter Beweis stellen wollen, bleibt der Widerspruch zwischen „einer von der Realität abgekoppelten Autonomie des Zeichens und dem kritischen Engagement von Elfriede Jelineks Schreiben“8 bestehen, was sich nicht zuletzt auch in der Rezeption abzeichnet: Während ein Teil der Kritik Elfriede Jelinek vorwiegend als große Sprachkünstlerin sehen will, beschränkt sich der andere auf das Inhaltliche, auf ihre Österreich-Kritik, auf ihre feministischen Aussagen etc. Und abgesehen davon, daß auch Elfriede Jelinek immer wieder auf Wirklichkeitsgehalt pocht, bleibt die Tatsache bestehen, daß sie geradezu obsessiv auf ganz bestimmte Inhalte rekurriert und zu ihrer Darstellung auf ganz bestimmte, sich im Lauf ihres Werks leicht modifizierende literarische Methoden zurückgreift. Warum also gerade auf diese und nicht auf andere, wenn doch das Zeichen autonom ist und der Autor nicht wirklich für seinen Text zuständig ist?
(Auszug)
[kolik 18]