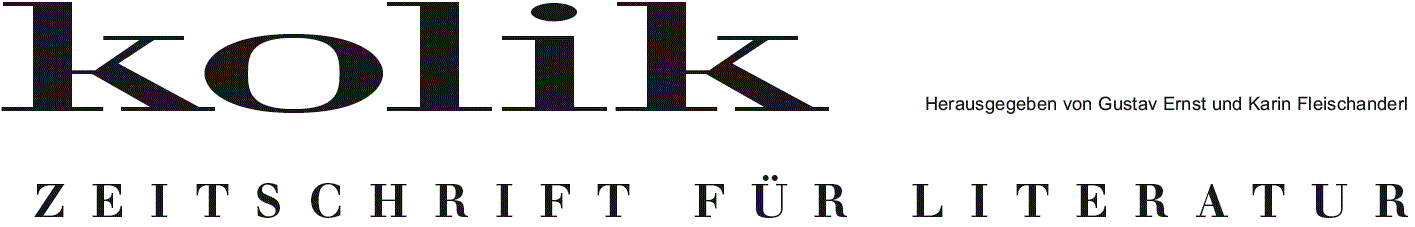Walter Hinderer
„Pneumatische Fetzen -
sprache“ oder „Askese
der Maßlosigkeit“:
Friederike Mayröckers
innovative Schreib -
weisen
Was ihre Prosa betrifft, so hat Friederike Mayröcker in einem Gespräch mit Siegfried
J. Schmidt im März 1983 unmißverständlich bekannt: „Ich will nicht in
einem üblichen Sinne erzählen, sondern mich an ein ganz unkonventionelles, unorthodoxes
Erzählverhalten annähern, wenn man so sagen kann.“ Nichtsdestoweniger
enthält der erste Band ihrer Magischen Blätter folgende relevante Geschichte:
„Mir geht es mit der Poesie so, wie meinem guten alten Zahnarzt aus Polen
mit seinem Auto – lassen Sie mich davon erzählen: Mein Zahnarzt, 72 Jahre, stammt
aus einem Dorf in Polen und wuchs in sehr bescheidenen Verhältnissen auf. Sein
Großvater, ein Goldschmied, von den Dorfbewohnern hochgeachtet, wurde nur
Moses Eljesa Goldschmied genannt. Immer wenn mein Zahnarzt, damals noch in
Polen und dreizehnjährig, von sich sprach, sagte er, ich, Jakob, Enkel des Moses Eljesa
Goldschmied. Er wurde Arzt, Zahnarzt und Menschenfreund. Er hielt nichts
vom Luxus im allgemeinen und vom Autobesitz im besonderen. Bis zu dem Tag,
als ihm ein wohlhabender Freund eines seiner Autos schenkte. Als mein alter Zahnarzt
vor etwa fünf Jahren zum erstenmal sein eigenes Auto bestieg, sagte er, wie unvorstellbar,
ich Jakob, Enkel des Moses Eljesa Goldschmied, fahre in meinem
eigenen Auto. Wie unglaublich, ich Jakob, Enkel des Moses Eljesa Goldschmied,
habe ein eigenes Auto. Dies wurde zur Obsession. Heute noch, wenn er sich ans
Steuer setzt, sagt etwas in ihm, wie ungeheuerlich, ich Jakob, Enkel des Moses Eljesa
Goldschmied, fahre in meinem eigenen Auto. –
Sehen Sie, so ergeht es mir mit meiner Poesie. Ich, ahnungslos aus einer hermetischen
Kindheit, ohne besondere Vorzeichen oder Vorzüge, entdecke eines
Tages, wie unvorstellbar, wie ungeheuerlich, wie unglaublich : ich schreibe meine
eigene Poesie.“
Schreiben ist für Friederike Mayröcker zweifelsohne eine unaufhörliche und
existenznotwendige Obsession, die sie schon in aller Frühe an den Schreibtisch
treibt, um in einem komplizierten Netzwerk Bilder, Erinnerungen, Ahnungen, Einsichten,
Lektürefetzen, Traum- und Gedankensplitter in ihren pneumatischen
Sprachkosmos zu verwandeln. Man könnte ihre ungewöhnlich umfangreiche, aber
in jeder Beziehung signifikante Produktion in ungefähr vier Phasen gliedern. Sie
reichen von einer Nähe zum Expressionismus und Surrealismus bis zu dem Einfluß
der experimentellen Dichtung von Eugen Gomringer, Helmut Heißenbüttel,
dem Lebensgefährten Ernst Jandl und der Wiener Gruppe und führen schließlich
zu den Entdeckungen eines originellen und unkonventionellen Erzählens, während
sie in der Lyrik eine eher gelöste, lockere Spontaneität entfaltet, die geradezu
blitzartig Gedanken, Bilder und Gefühle verbindet. Was Friederike Mayröckers imposante
Produktion jedoch jenseits aller feststellbaren Phasen auszeichnet, ist die
nahezu magische Art und Weise, wie es ihr gelingt, ihre eigenen Werke, sei es nun
Lyrik oder Prosa, immer wieder durch neue Sprachfindungen und Schreibweisen
zu übertreffen.
Obwohl schon von der Herkunft her Friederike Mayröcker in die österreichische
Tradition gehört, in welcher der Sprachzweifel gewissermaßen zu Hause
ist, scheint sie davon unberührt geblieben zu sein. Die Diskrepanz von Sprache
und Welt wird sowohl von Wittgenstein als auch von Karl Kraus als Bruch in der
eigenen Existenz erfahren. Will der eine in seiner Philosophie die Sprachgefangenen
aus ihrem Sprachgefängnis führen, so beobachtet der andere: „Wenn ich
nicht weiterkomme, bin ich an die Sprachwand gestoßen. Dann ziehe ich mich mit
blutigem Kopf zurück. Und möchte weiter.“
Unser Denken, so argumentierte bekanntlich bereits Friedrich Nietzsche, ist
durch ein sprachliches Regelprogramm programmiert –und er merkt ebenso kritisch
wie misogyn an: „Die >Verunft< in der Sprache: oh was für alte betrügerische
Weibsperson! Ich fürchte, wir werden Gott nicht los, weil wir noch an die
Grammatik glauben …“
Solche Kritik geht von der Überzeugung aus, daß in der Sprachstruktur unwiderrufbar
und kaum ablösbar eine Weltinterpretation enthalten ist. Die linguistische
These „vom sprachlichen Weltbild“, wie sie noch bei Humboldt, Sapir,
Whorf und Weisgerber auftaucht, wird gerade im Hinblick auf die Literatur differenziert
und um die „syntagmatische Dimension“ erweitert, wie Harald Weinrich
in seinen Linguistischen Bemerkungen zur modernen Lyrik einleuchtend aus der Perspektive
der Textlinguistik darstellt. Eugenio Coseriu hat in diesem Zusammenhang auf die
Bestimmung der dichterischen Sprache durch die Prager Schule als „entautomatisierte
Sprache“ verwiesen, welche die „volle Funktionalität der Sprache“ als solcher
„wiederherstellt“. So verstanden wäre Dichtung als „Verabsolutierung der
Sprache zu interpretieren“, wobei die Verabsolutierung aber Coseriu zufolge „nicht
auf der sprachlichen Ebene als solcher erfolgt, sondern auf der Ebene des Sinnes
der Texte“. Je komplexer Texte jedoch angelegt sind, desto schwieriger dürfte es
sein, schlüssig eine eindeutige Sinnebene auszumachen.
Wie dem auch sei, Sprachkrise oder Sprachbesessenheit, Zweifel an der Sprache
oder die Vorstellung, von der Sprache behext zu sein, scheint, denkt man an
Franz Grillparzer, Hugo von Hofmannsthal, Hermann Broch, Robert Musil auf der
einen und dann an die Wiener Gruppe um Achleitner, Artmann, Rühm bis Jandl auf
der anderen Seite, trotz allem eine österreichische Spezialität zu sein. Um so erstaunlicher
mag es in diesem Zusammenhang erscheinen, daß sich Friederike Mayröcker,
wie sie eigens in einem Gespräch mit Robert Stauffer betonte, nie zur
konkreten Poesie oder der Wiener Gruppe zugehörig fühlte. Mayröckers Fall ist
eindeutig nicht der des Philipp Lord Chandos, dem „völlig die Fähigkeit abhanden
gekommen“ war, „über irgend etwas zusammenhängend zu denken oder zu sprechen“,
dem „alles in Teile, die Teile wieder in Teile“ zerfiel und der darüber klagte,
daß sich „nichts mehr … mit einem Begriff umspannen ließ“. Um so erstaunlicher
ist es, daß Mayröcker in einem Brief an Lord Chandos, entstanden am 4. Dezember
2001, bekannte, daß auch sie einst von einer solchen Krise heimgesucht
worden sei. Sie empfahl dem Lord allerdings das gleiche Heilmittel, das sie von der
lästigen Krankheit wirkungsvoll befreit hatte: nämlich den totalen Rückzug auf
sich selbst und das Ausblenden aller sozialen Kontakte. Dieses Heilverfahren führte
dazu, daß sie keine Briefe beantwortete, nicht mehr ans Telefon ging, worauf sich
ihr Zustand von Tag zu Tag zu verbessern begann. Bald darauf fielen ihr am frühen
Morgen „ganze Wortgewimmel und Wortgestöber“ ein, „so daß sie mit dem Notieren
kaum nachkam“. Immer heftiger begann sich in ihr „die schwarze
Stichflamme der Eingebung (Leidenschaft) zu regen“, so daß sie kaum den nächsten
Morgen erwarten konnte, der sie „wieder an die Maschine treiben würde“. Es
ist in der Tat ein Mahlstrom, der ihre fulminante Schreibexistenz „hin und her
schleudert“, wie sie die gleichermaßen unterbewußten und bewußten Energien
beschreibt.
Ich will versuchen, wenigstens ein paar relevante Passagen aus dem grandiosen
Prosatext mein Herz mein Zimmer mein Name (1988) zu zitieren. Mayröcker inszeniert
hier ohne Pause über 314 Seiten einen geradezu atemberaubenden
Sprachmarathon, der selbst bei dem Leser einen Lesefuror auslöst. Diese „Schreibarbeit“
ist, wie die innovative figurale Schreibweise im Text nahelegt, „eine
Ohrenbetäubung, ein Narkotikum …, gleicherweise Gift und Arzneimittel, wie
die Außenwelt, ebenso wie die Außenwelt mir Gift und Arzneimittel ist, ohne
Außenwelt keine Schreibarbeit möglich …, erst zerstreue ich alles, dann sammle
ich alles ein, ich schreibe mich selber ab, ich komponiere eine bereits vorhandene
Partitur, dieser wuchernde Schädel, sage ich, dieser Gangliendschungel, dieses
Hirngestrüpp findet eine Entsprechung in diesem unseren wuchernden Haus-Unwesen
…“.Außenwelten und Innenwelten, Traumsplitter und Bewußtseinsblitze,
visuelle und akustische Impulse treffen sich in der Ich-Gestalt, „im Zentrum“, wo
„Gedanken, Gefühle, Vorstellungen … anwesend sind“. Andererseits moniert das
Schreibsubjekt gleich wieder die Defizite, die Erinnerungslosigkeit, die Anstrengung,
sich „aus jeder Sache herauszuhalten, [sich] abzusetzen“, um ein ungestörteres
Fürsichsein zu bewahren. Diese wenigen Stellen illustrieren bereits, wie die
kühne produktionsästhetische Verfahrensweise herkömmliches Erzählen negiert
und die theoretischen und rhetorischen Voraussetzungen dieser Verfahrensweise
gleichzeitig im Text eingeschrieben sind. Es fällt in diesem Zusammenhang das
oxymorische Stichwort von der „Askese der Maßlosigkeit“, die alles „Überfließen“,
die „göttliche Barbarei“, die Schreibekstase strengen formalen Kontrollen unterstellt.
Mit anderen Worten: Maßlosigkeit wird durch sprachliche und formale Askese
und Disziplin in Kunst verwandelt. Das geschieht allerdings mit einer
traumwandlerischen Sicherheit, wobei das Überangebot von Einfällen, wie die Autorin
immer wieder betont, aus dem „Schlafzustand“ kommt, der sich allerdings
bereits an der Grenze zum „Aufwachzustand“ und im Übergang zum „Arbeitszustand“
befindet.
Schreiben und Leben sind für Mayröcker Namen eines Begriffs, wobei alle exorbitanten
Elemente ihrer Existenz, seien es Bilder, Jugenderinnerungen, Briefe,
literarische Texte, alle Erfahrungen der Vergangenheit und Gegenwart, zur Sprache
gebracht werden. In dem wegweisenden frühen Text Die Abschiede, der zwischen
April 1978 und Januar 1980 entstand, wird bereits auf den „innern Aufbau“ und
die Schreibart verwiesen, auf die „lebhaften und rhythmisch wiederkehrenden Bewegungsabläufe“.
Schon in diesem frühen Text fällt auf, daß poetische Mittel die
Prosa aufladen, in Bewegung halten und sich „ins Fleisch der Sprache“ verbeißen,
wie es an einer Stelle der Abschiede heißt. Wiederholungen und Varianten von Leitmotiven,
was auch Mayröcker mit der Redefigur der „Unterfütterung“ ausdrückt,
gehören ebenso zum Repertoire wie die permanente Überlagerung von Sememfeldern.
In einer spezifischen Anweisung veranschaulicht der Text das angewandte
Verfahren folgendermaßen: „erinnern Sie sich, die düster-reglosen Vögel am Himmel,
eine rauhe Zerreißung (von Träne) und niedergeschwätztes Gebot, ganz so
wie der Geist Sie mir in Erinnerung (brüllt): brüllend und gurgelnd, vor Besessenheit,
müsse die Sprache sein, jeder Satz müsse seine ihm gemäße Struktur aufweisen, geschwänzt
gezwirbelt gezwitschert: so eigenwillig müßten die Wortbilder, und raketengleich,
in die Höhe schießen, eine Verwandlung von Körper und Seele, ein
Zusammenbacken und -kleben, gedankenvolles Stiefmütterchen: oder als wollten
sich die Sätze nahtlos und wie von selber aneinanderreihen.“ Extreme Situationen
und Sensationen, Grenzbereiche sinnlicher und geistiger Erfahrung, Zustände
von Delirien und Halluzinationen werden in den Sprachstrom ebenso eingeschleust
wie Alltagserlebnisse, Korrespondenz- und Lektüresplitter, kreative Reminiszensen
aus Literatur, bildender Kunst, klassischer Musik und Essayistik. Alle Teile
fügen sich zu einer dichten, durchgearbeiteten Partitur, in der sich Begriffe der
Traumtechnik wie Verdichtung und Verschiebung von Freuds Traumdeutung ebenso finden
wie die von Gotthilf Heinrich Schubert in seiner Symbolik des Traumes projektierte
„höher[e] Art von Algebra …, die aber nur der versteckte Poet in unserm Innern
zu handhaben weiß“. Polyphone Symbolfelder und Symbolverschachtelungen
führen die entgegengesetzten Bereiche, welche ins Netz der Sinne fallen, aufeinander
zu. In „solcher Spannung zu leben“, so ruft das Schreibsubjekt im Text
aus, „gleichzeitig das Auge ans Nahe zu heften und in die hemisphärische Weite
und Ferne zu lenken: sei die (schicksalhafte) Voraussetzung für poetische Erfahrungen
und Erkenntnisse überhaupt, wie sie, durch die verzehrende Wahrnehmung
der Außenwelt vermittelt, im kalten Feuer einer wahnhaften und süßen
Besessenheit von Urform zu Endform gewandelt, schließlich in einer anderen
neuen (reflektierenden) Wirklichkeit wiedererstanden erscheinen“. Zu einer „totalen
Funktionalisierung von Sprache“ trägt auch die selektive Verwendung oder
Aussparung von Satzzeichen bei. Mayröcker zufolge schaffen beispielsweise „die
Schrägstriche eine gewisse Distanz zwischen den einzelnen Satzzeichen …, die
andererseits durchlässiger ist als die Distanz durch Punkt oder Strichpunkt oder
einen anderen Bruch im Satz“. In den Abschieden verwendet sie außerdem häufig
den Konjunktiv; er schafft für sie „eine Art Guckkasten, also etwas, was man anschauen
kann“. Überdies erlaubt er ihr, „Szenen und Zusammenhänge völlig zu
objektivieren“. Aus diesem Grunde habe sie vieles, was sie in der Ich-Form geschrieben,
„entschärft“, indem „sie es in die 3. Person und in den Konjunktiv“ versetzte.
Wenn Robert Musil seinen Fragment gebliebenen Roman als „Essay von
ungeheuren Dimensionen“ bezeichnet, der sich prononciert gegen jede Art von
traditionellem Erzählen richte, und die „Geschichte dieses Romans“ dergestalt erläutert,
„daß die Geschichte, die in ihm erzählt werden sollte, nicht erzählt wird“,
so könnte man das ebenso für Mayröckers Prosaarbeiten reklamieren, die in ihrer
kontinuierlichen Reihenfolge ein monumentales Schreibexperiment darstellen, das
nicht zur Ruhe und zu keinem Ende kommt. Die aufeinanderfolgenden Teile einer
progressiven Universalprosa, um hier die bekannte Formulierung Friedrich Schlegels
gezielt zu verändern, scheinen eine romantische Dichtart auf eigenwillige und
kreative Weise fortzusetzen, eingedenk der Einsicht, daß „ihr eigentliches Wesen“
darin besteht, „daß sie ewig nur werden, nie vollendet sein kann“....(Auszug)
[kolik ]