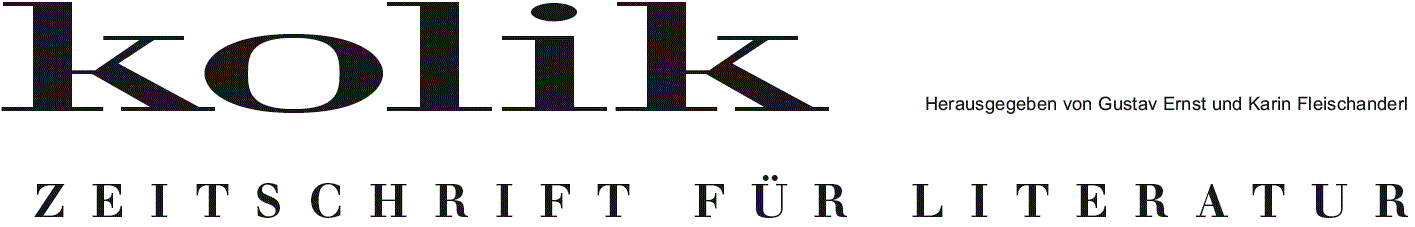Laura Freudenthaler
Zähne zusammenbeißen
Der Rundgang beginnt an der Wohnungstür. Im Vorzimmer ist die Tür zum Bad,
dort stellt sie sich vor den Spiegel und untersucht ihre Kiefermuskulatur. Wenn die
Sonne hoch steht, fällt ein wenig Licht durch das Fenster auf die Fliesen. In der
Sackgasse unter dem Fenster hat sie noch nie einen Menschen gesehen und das
Haus gegenüber steht schon immer leer. Vor den mit Brettern vernagelten Fenstern
sitzen die Tauben und putzen ihr Gefieder. Sie würde gerne abends an einem Fenster
stehen und warten, bis er auftaucht, ihn beobachten, wie er die Straße entlanggeht,
bis er im Hauseingang verschwindet und kurz darauf die Wohnungstür
von außen aufsperrt, doch in der Wohnung gibt es kein Fenster, das auf die Straße
hinausgeht, in der der Hauseingang liegt. Sie mag die verlassene Sackgasse nicht
und nicht die Tauben, die sie besetzt halten. Sie geht durch das Vorzimmer, bleibt
kurz im Durchgang zur Küche stehen, der keine Tür ist, sondern ein runder Bogen
in der Wand. In der Küche gibt es nur ein kleines Fenster ein wenig über Kopfhöhe,
darunter die Sackgasse, gegenüber das Taubenhaus. Sie beißt die Zähne zusammen
und geht im Wohnzimmer die Wände entlang bis zum Fenster. Unter dem Wohnzimmerfenster
ist ein breiter verwilderter Streifen Natur, daran schließt sich die
fensterlose Rückwand eines Gebäudes, das gerade so hoch ist, dass sie den Horizont
sehen kann, aber nicht, was dahinter ist. Auf dem Streifen, auf dem das Gras
und die Disteln hoch wachsen, kommt immer wieder Schrott zu liegen, ohne dass
sie je gesehen hätte, wie jemand ihn ablädt. Autoreifen, die Metallteile eines Bettgestells
und dazwischen die Katzen, denen das Stück Land gehört. Als sie in den
Süden gekommen ist, hat sie erwartet, hier nicht allein sein zu können. Sie hat erwartet,
es würde überall Leben sein und in jedem Gässchen würden Schnüre gespannt
sein zwischen den Häusern und darauf würde Wäsche zum Trocknen
hängen. Sie hat Lärm erwartet und Stimmen und Geschrei, Hundegebell und zankende
Katzen, und sie hat sich auch auf Gestank und Rücksichtslosigkeit eingestellt,
aber sie glaubte zu wissen, dass sie dafür mit diesem unbändigen Leben
entschädigt würde, auf das sie sich so gefreut hatte. In der Wohnung ist es still. Er
bezeichnet seine Wohnung gern als eine Oase im Irrsinn der Stadt. Sie geht durch
das Schlafzimmer und tritt auf den Balkon. Der Balkon geht auf den Innenhof hinaus
und ist groß genug für einen kleinen runden Tisch und zwei Klappstühle. Der
Balkon ist groß genug für sie, um hier zu leben, und er ist der einzige Zugang zum
Leben der anderen. In der Mitte des Innenhofs umranden die Pflastersteine einen
runden Fleck Erde, darin wächst ein Baum, der noch nicht sehr hoch ist. An einer
Wand stehen die Pflanzen der Frau mit der blauen Kittelschürze und im Eck die drei
Mülltonnen nebeneinander. Es gibt Bewohner, die ihren Müll morgens hinausbringen,
bevor sie zur Arbeit gehen, nur die Alten kommen im Laufe des Vormittags,
und spätabends, wenn gekocht wird und die Geräusche aus den Küchen, von
den Fernsehgeräten, die Kinderstimmen und die Stimmen der Paare in den Hof
dringen, werden die Männer und die Kinder mit den Müllsäcken in den Hof geschickt,
und manchmal stehen welche und unterhalten sich, bevor sie wieder in
ihre Wohnung zurückgehen. Jeden Vormittag steht sie am Balkon und wartet auf die
alte Frau mit der blauen Kittelschürze, die kommt, um ihre Pflanzen zu gießen, Tomatenstauden,
Basilikum und Begonien. Seit kurzem wächst in einem großen Topf
auch ein Kürbis. Morgens taucht die Sonne hinter dem Haus zu ihrer Rechten auf
und bleibt bei ihr, bis sie hinter dem Haus zu ihrer Linken untergeht. Die Sonne
steht entschieden links, das Licht ist bereits weich und satt. Wenn es ein normaler
Tag ist, wird er bald die Wohnungstür von außen aufsperren. Sie steht am Balkongeländer
und befühlt ihre Zähne. Sie tastet ihre Backenzähne ab. An ihrem Zeigefinger
rinnt ein Tropfen Speichel hinunter und sie nimmt ihn aus dem Mund und
hält ihn in die Sonne. Sie hört, wie die Wohnungstür aufgesperrt wird, und betrachtet
ihren glitzernden Zeigefinger. Bis er auf den Balkon tritt, ist der Speichel
an ihrer Hand in der Sonne getrocknet. „Hier bist du“, sagt er und stellt sich neben
sie ans Balkongeländer. „Du genießt die Sonne, du glückliches Mädchen. Ich bin
heute nicht eine Minute aus dem Büro hinausgekommen.“ Er schließt die Augen,
hält das Gesicht in die Sonne und seufzt. Sie tastet wieder mit dem Zeigefinger an
ihrem spitzesten Backenzahn herum. Als er die Augen öffnet, holt sie ihn schnell
aus dem Mund und legt ihn speichelglitzernd aufs Balkongeländer. „Hattest du
einen anstrengenden Tag?“, fragt sie und er sagt: „Wenn du wüsstest, wie schwierig
die Leute sind. Sei froh, dass du keine Mitarbeiter hast.“ „Oh“, sagt sie, „ich
hätte gerne ein bisschen Macht und könnte Untergebene dirigieren.“ Er lacht und
nimmt sie um die Hüfte. „Du wärst ein furchteinflößender Chef, mein Mädchen.“
Sie legt die Arme um ihn und wischt ihren Zeigefinger an seinem Hemdrücken trocken.
„Mein furchteinflößendes Mädchen“, sagt er an ihrem Ohr.
Er ertrage ihre Taktlosigkeit nicht mehr, sagt er. Sie sind nachhause gegangen,
ohne zu sprechen, und schweigend hat er die Wohnungstür aufgesperrt. Er ist in
die Küche gegangen, sie ihm nach, er hat ihr den Rücken zugewandt und sie hat
gesagt, er wirke bedrückt. Er könne nicht mehr mit ansehen, sagt er, wie sie in
ihrer Taktlosigkeit sich unmöglich mache und ihn unmöglich mache. Er sitze daneben
und müsse ungläubig mit anhören, was sie von sich gebe, er sitze daneben
und könne nicht verhindern, dass sie Ungeheuerlichkeiten produziere, und je-
mand müsste ihr beibringen, was ihr völlig fehle, nämlich Takt. Takt habe durchaus
etwas mit Musik zu tun, sagt er, Takt bedeute nämlich, das richtige Wort im
richtigen Moment zu sprechen und das falsche Wort im falschen Moment zu erkennen
und zu vermeiden. Es gehe um den Moment und seinen Charakter, sagt er,
es gehe um das Timing, wenn sie so wolle, beim Takt. Aber sie habe doch nur eine
Geschichte erzählt, von der sie gedacht habe, dass sie komisch sei, sagt sie, und vielleicht
habe sie die falschen Worte verwendet, falsche Nuancen, und das doch nur
deshalb, weil die Sprache für sie eine fremde sei. Er sagt, sie solle sich nicht über
ihn lustig machen, sie habe nie ein Problem, den richtigen Ausdruck zu finden, und
nur wenn es ihr in den Kram passe, dann sei sie quasi schuldunfähig, weil ja die
Sprache für sie eine fremde sei, und er würde gerne hören, mit welchen Worten
sie Geschichten darüber erzählen wolle, wie er sich in ihrem Land lächerlich gemacht
habe, ohne ihn vollkommen lächerlich zu machen. Aber es hätten sich doch
alle amüsiert, ruft sie. Selbstverständlich hätten sich alle amüsiert, entgegnet er,
nämlich auf seine Kosten. Jeder habe Geschichten erzählt, sagt sie, wie er in einem
fremden Land ins Fettnäpfchen getreten sei, aber niemand habe sich über ihn lustig
gemacht, er habe das falsch verstanden. Sie solle ihm nicht erzählen, was er
wie zu verstehen habe, sagt er, schließlich sei das sein Land und er könne sehr gut
beurteilen, wann eine ganze Runde herzlich über ihn lache, im Gegensatz zu ihr,
die ihn entweder naiv oder bösartig zum Deppen mache. Sie habe das nicht gewollt,
sagt sie, und wenn sie ihn wirklich der Lächerlichkeit preisgegeben habe,
dann tue es ihr leid. Sie verstehe immer noch vieles nicht, sagt sie, und heute Abend
habe sie sich einfach amüsiert und sei spontan gewesen und immer wieder vergesse
sie, dass sie in diesem Land nicht spontan sein dürfe, und tappe in die Falle,
wenn sie entspannt sei und sich amüsiere und dabei vergesse, dass sie in diesem
Land nicht spontan sein dürfe. Man sei in seinem Land sogar sehr spontan, sagt er,
man sei spontaner als sie, aber man habe eben dieses gewisse Taktgefühl, das die
Spontaneität überhaupt erst erlaube. Takt sei nämlich, sagt er, per se etwas, worüber
man nicht nachzudenken brauche, und sie werde wohl nie Takt entwickeln,
weil sie nämlich eine Grüblerin sei. Das Grübeln aber, sagt er, verhindere die Leichtigkeit,
die das natürliche Gefühl für Takt auszeichne, und sie komme schließlich
aus dem Land der Grübler, weshalb es dort mit der Leichtigkeit nicht weit her sei.
Aber es müsse doch schließlich, sagt er, auch in ihrem Land gewisse Verhaltensregeln
geben, auch in ihrem Land müsse es doch gewisse Dinge geben, die man tut,
und solche, die man nicht tut. Der gute Ton, das sage man doch in ihrer Sprache,
zumindest gebe es in ihrem Land also einen guten Ton und er frage sich, ob es da
wirklich zum guten Ton gehöre, seinen Mann der Lächerlichkeit preiszugeben. Der
gute Ton sei keine Intuition, sondern ein Regelkorsett, sagt sie. Während er an die
Arbeitsplatte gelehnt steht, beide Arme hinter sich aufgestützt, hat sie sich auf den
Stuhl an der Wand gesetzt. Sie spürt, wie zusammengesunken sie dasitzt, aber sie
kann sich nicht aufrichten. In jedem Fall, sagt er, besitze sie kein Taktgefühl, und
er trommelt mit den Fingern auf die Arbeitsfläche hinter sich, und er habe keine
Lust mehr, sie irgendwohin mitzunehmen und dann danebensitzen und mitansehen
zu müssen, wie sie Ungeheuerlichkeiten produziere. Es gehe ihr, sagt er, jedes
Gefühl dafür ab, wie man sich in Gesellschaft verhalte, dieses Gefühl könne sie
nennen, wie sie wolle, Takt oder Ton oder Schlag. Den Ausdruck gebe es doch in
ihrer Sprache, sagt er, jemand habe einen Schlag? Sie sagt, jemand habe einen Hau,
und sofort macht sie den Mund wieder zu, denn sie spürt das Weinen, das in ihrem
Gesicht sitzt. Die kleinen Arme des Weinens haben sich um ihre Augen gelegt, unter
der Haut sitzen die Tränen und warten. Sie schließt den Mund und spannt die Gesichtsmuskeln,
um die Tränen zurückzuhalten. Sie beißt sich auf die Lippen und
spannt die Halsmuskulatur bis hinunter zum Schlüsselbein. Zwei Dutzend Muskeln
bringt sie in Stellung, um das Weinen zu verhindern, aber die Tränen sitzen
schon unter der Haut und sind viele und durch ihren Druck lösen sich die feinen
Muskeln um die Augen. Als die feinen Muskeln rund um die Augen nachgeben, ist
die Spannung nicht mehr zu halten. Ein Muskel nach dem anderen gibt nach, und
als sie aufschluchzt, sieht er sie an. Er unterbricht sich mitten im Satz und kommt
zu ihr. Er kniet sich vor sie hin und betrachtet die Tränen, die über ihre Wangen und
am Unterkiefer entweder weiter am Hals entlangrinnen oder von dort auf die Brust
tropfen. Er sagt, sie solle doch nicht weinen, das habe er nicht gewollt, und mit den
Fingern fängt er die Tränen auf, die über ihre Wangen rinnen. Er betrachtet ihr
Weinen und will ihre Tränen berühren, während sie dagegen ankämpft und vor der
Nässe der Tränen erschauert. Er beugt sich nach vorn und küsst ihre Wangen. Er
drückt seinen Mund auf ihr Gesicht und sucht mit den Lippen die Tränen. Seine
Lippen verteilen die Tränennässe auf ihrem Gesicht. Sie versucht ihre Gesichtsmuskulatur
in den Griff zu bekommen. Sie spannt Halsmuskeln und Schultern an,
um das Schluchzen zu verhindern, während er seine Lippen über ihre Wangen bewegt
und auf ihre Augen legt. Sie muss die Augen schließen und er legt den Mund
auf ihre Lider, zuerst auf das eine, dann auf das andere. Sie beißt die Zähne zusammen
und presst die Kiefer aufeinander. Von der Kaumuskulatur ausgehend bekommt
sie ihr Gesicht wieder unter Kontrolle. Die Spannung im Kiefergelenk greift
über auf die oberflächlichen Muskeln rund um die Lippen und an den Wangen. Die
Spannung ergreift die feinen Muskeln um die Augen und die Tränen versiegen, das
Schluchzen verebbt und der Mund zittert nicht mehr. Er nimmt den Hocker, der
im Eck steht, und setzt sich ihr gegenüber, nimmt ihre Hände in seine. Sie muss
durch den Mund atmen, weil ihre Nebenhöhlen vom Weinen voller Rotz sind, den
sie durch die Nase hochzieht. Sie bräuchte ein Taschentuch, aber er hält ihre Hände
in seinen und sieht sie fest an. Er sagt, es tue ihm leid, er habe sie nicht zum Weinen
bringen wollen....(Auszug)
[kolik ]