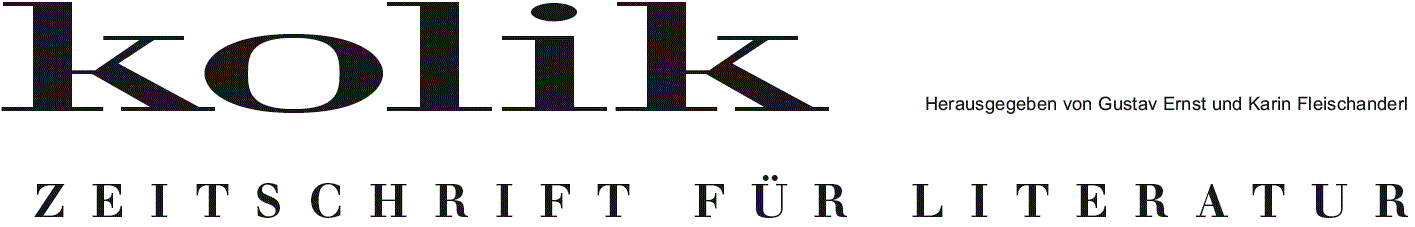Leopold Federmair
Der begehrliche Blick
Überlegungen zu einer schwulen Ästhetik am Beispiel Josef
Winklers
1 Gibt es eine schwule Ästhetik?
Auf diese Frage weiß ich natürlich keine Antwort. Gibt es eine Raucherästhetik?
Eine österreichische Literatur? Eine weibliche Poetik? Es gibt Werke von
Italo Svevo, Robert Musil oder Ingeborg Bachmann. Soviel scheint sicher zu sein.
In Sodom und Gomorrha stellt Marcel Proust die Schwulen in eine Reihe mit den
Juden, Vegetariern, Anarchisten, Wehrdienstverweigerern. Bei allen diesen handelt
es sich um Sondergruppen innerhalb einer dominanten Gesellschaft – das
trifft auf die Raucher, die Österreicher und die Frauen nicht oder nur
sehr bedingt zu. Andererseits lehrt schon ein flüchtiger Blick, sei es
von innen oder von außen, auf die sogenannten schwulen Szenen, die sich
ja heute nicht mehr verbergen müssen wie noch zu Zeiten Prousts, daß
diese Szenen eigene Codes, Sprachen, Vorlieben, Ikonen, Kleidungsstile usw.
ausgeprägt haben. Was nicht heißt, daß sich jeder, der homosexuell
ist, dieser Sprachen und Stile bedienen muß.
Es gibt also eine Literatur von Oscar Wilde, Marcel Proust, Hans Henny Jahnn,
Jean Genet, Yukio Mishima, Hubert Fichte, Pier Paolo Pasolini, Josef Winkler
– und die Frage ist nun, ob sie als Autoren etwas gemeinsam haben oder
nicht. Von den Genannten weiß man, meist durch sie selbst, daß sie
homosexuell waren oder sind. Nicht alle haben die Homosexualität in gleicher
Weise zu einem Thema oder Anliegen gemacht. Und selbst wenn sie es getan haben,
stellt sich die Frage, ob die Sprache, in der sie es getan haben, eine spezifische
Differenz aufweist oder nicht; ob sie also besondere Merkmale, die zu den allgemeinen
Merkmalen einer Literatursprache hinzukommen oder sich gegen diese wenden, aufweisen
oder nicht. In bezug auf Josef Winkler kommt Friedbert Aspetsberger zu dem Schluß,
dessen „Position des konträren Geschlechts“ sei lediglich „temporär“
gewesen und von ihm mittlerweile verlassen worden. Bleibend in Winklers Werk
und, so habe ich Aspetsberger verstanden, bleibend in der allgemeinen Literaturgeschichte
sei die Figur des Vatermörders. Daß Winkler nach den schwulen Verwirrungen
seines Frühwerks auf das Wesentliche zurückgekommen sei, auf die Auseinandersetzung
mit dem Vater und seinem harten Gesetz, verschaffe ihm erstmals Zugang zum Mainstream
der Literatur. Mit der Abkehr von der homosexuellen Thematik gingen dem Autor,
so Aspetsberger, nun auch die Pferde des Erzählens nicht mehr durch. Das
reife Werk ist abgeklärt, geglättet, beherrscht.
Diese Sorge aufgrund der Abwege, die einen literarischen Sohn von der Hauptstraße
der Literatur wegführen, kann ich verstehen. Die schwule Ästhetik,
wenn es sie gibt, läuft nämlich eine Gefahr: die Gefahr der Ghettoisierung.
Wie es in den Großstädten Lokale gibt, die der Heterosexuelle nicht
frequentiert, gibt es auch eine Literatur, die dem gewöhnlichen Leser unbekannt
ist, weil sie in besonderen Verlagen erscheint und in besonderen Buchhandlungen
verkauft wird. Ein Autor wie Winkler, nehme ich an, will nicht in so einem Ghetto
verschwinden. Übrigens genügt ein flüchtiger Blick, ein flüchtiges
Blättern, um zu erkennen, daß die Literatur der schwulen Ghettos
viel weniger als die der eingangs genannten Autoren, die von einem allgemeinen
Publikum gelesen wird, eine eigene Sprache spricht.
Bei Franz Haas ist die Sorge wegen Winklers sexueller Obsessionen noch deutlicher
spürbar. In Hinblick auf den Indien-Roman Domra schreibt Haas, und man
kann da ein Aufatmen hören: „Die Schilderungen homosexueller Erlebnisse
sind selten und vergleichsweise keusch.“1 Winkler hat, so die Wahrnehmung
des Interpreten, zum wesentlichen Thema zurückgefunden – nicht zum
Vater, nein, sondern zum Tod. (Aber vielleicht ist der Tod der letzte Inbegriff
des Vaters, die höchste Autorität, unter der beide, Vater und Sohn,
erzittern.) Und mit dieser Rückkehr geht Haas zufolge ein Zugewinn an Realismus,
an Objektivität einher: Die alte Egomanie, das ichbezogene Schreiben ist
überwunden.
Ich verstehe die Sorgen über Winklers Abwege, aber ich teile sie nicht.
Im Gegenteil, mich interessieren diese besonders, und ich glaube, daß
sie für Winklers Schreiben wesentlich und daher auch kaum zu „überwinden“
sind. Allerdings muß ich hinzufügen, daß mich nicht nur, nicht
in erster Linie die homosexuelle Thematik interessiert und berührt, die
einen der wenigen Behälter darstellt, in die der Autor das von ihm eifrig
gesammelte Material gibt (der Katholizismus, das Dorf, der Tod, autoritäre
Gewalt), sondern eben die besondere Wahrnehmungsweise, die Sprache und die Kompositionstechniken,
zu denen Winkler gefunden hat und an deren Perfektionierung er arbeitet. Ich
meine nämlich, daß zutrifft, was Proust schrieb und viele andere
sagten, daß nämlich der Schwule mit seiner Ästhetik, sofern
er eine besitzt – daß also der Schwule mit seiner Wahrnehmungsweise
(Aisthesis) und Ausdrucksweise (Semiosis) einen besonderen Fall unter den Sondergruppen
darstellt, daß er also die Freimaurer, Juden, Raucher, Anarchisten usw.
vertreten und für sie sprechen kann, wie es Winkler ja auch auf der inhaltlichen
Ebene seiner Bücher immer wieder tut, wenn er all die Zigeuner, Bettler,
Transvestiten, Neger, Krüppel, Sandler mit einer Besessenheit beschreibt,
die bewirkt, daß sie seinen Erzählkosmos zunehmend beherrschen. Denn
das ist es, was ich schon eher als eine – sehr langsame – Wende
in Winklers Schaffen sehe: dieses Sichbreitmachen der Außenseiter anstelle
der Dorfbewohner, anstelle der Arbeitstiere und Selbstmörder, der Unterdrücker
und Unterdrückten. Winklers Erzähler, ob er nun persönlich in
Erscheinung tritt oder nicht, ob er sich mehr auf sich selbst oder auf das Wahrgenommene
bezieht, ist einer von ihnen, und zwar nicht als Bettler oder Krüppel oder
windiger Marktverkäufer, sondern als Schwuler. Ein „Mitarbeiter“
auf der Piazza Vittorio Emanuele, der dort seine „Schreibarbeiten“
verübt.
2 Inversion, Perversion, Affirmation
Proust nennt die Schwulen „les invertis“, weil er das in seinen
Ohren allzu deutsch und pedantisch klingende Wort „Homosexualität“
vermeiden möchte. Außerdem bewahrt das französische Wort etwas
von der Bildlichkeit der Verkehrung und kann damit die Überzeugung ausdrücken,
die auch Proust teilte, daß im männlichen Körper des Schwulen
– Proust bezog sich auf Tunten wie Robert de Montesquiou, den er in der
Recherche unter dem Namen Baron de Charlus porträtierte – eine Frau
gefangen sei wie in einem Gefängnis, das sie nur unter Schwierigkeiten
verlassen könne. Das Wort „Inversion“ ist dem auch im Deutschen
geläufigen Wort „Perversion“ verwandt. Offenkundig vermied
es Proust, weil ihm dessen abwertende Bedeutung nicht in den Kontext paßte.
Die Rede von der Inversion formalisiert aber nicht nur einen schwer entwirrbaren
Komplex sexueller Dynamiken, sie verweist zugleich auf die soziale Position
des Homosexuellen und auf seine wesentlichen Möglichkeiten, mit dieser
Position umzugehen, sie eventuell zu verändern. Das Werk von Jean Genet
ist durch Umkehrungsfiguren strukturiert, aber diese Figuren sind den existentiellen
Erfahrungen nachgebildet, die der Autor als Kind und junger Mann machte. Die
Besserungsanstalt für junge Verbrecher wird bei ihm zum Paradies, weil
ihm die Gesellschaft keine andere Möglichkeit läßt, als im Universum
solcher Anstalten zu leben. Wenn der schwule Dieb keine Aussicht hat, eine Position
innerhalb der guten Gesellschaft zu erringen, dann dreht er den Spieß
eben um und erklärt das, was der Bürger als Hölle erachtet, zum
Paradies. (Eine ähnliche Umkehrung hat übrigens Jahre später
Imre Kertész unternommen, als er das Konzentrationslager, in dem er aufwuchs,
zu einem Ort der Geborgenheit und diese Umkehrung zum Angelpunkt seines Romans
eines Schicksallosen machte.) Der schmutzige Herumtreiber, dem die Gesellschaft
ein ums andere Mal sagt, daß er unheilbar böse ist, sucht sein Heil
darin, daß er das Böse und das Häßliche zum Guten und
Schönen erklärt.
Die Übereinstimmung mit den Versuchen Nietzsches, die überkommenen
Werte umzuwerten, ist meines Erachtens nicht nur verbal. In beiden Fällen
wendet sich ein an den gesellschaftlichen Rand gedrängtes Individuum frontal
und mit aller Macht und Verzweiflung, die ihm zu Verfügung steht, gegen
die Gesellschaft, gegen den historischen Mainstream. Die großen Umkehrungskonzepte
Nietzsches konnten sich auf den von ihm vorgesehenen Ebenen nie verwirklichen:
Sie konnten nie zu gesellschaftlicher Macht gelangen. Was aber im 20. Jahrhundert
geschah, ist die Freisetzung diverser kleiner Umkehrungspotentiale, ein Wuchern
von Minderheiten, die Inversionen entfalten, aber nicht unbedingt nach Macht
streben. Der Verkehrte weiß, daß er, um das Spiel der Verkehrung
zu spielen, auf seine minoritäre Position angewiesen ist. Wird er Teil
des Mainstreams, gehen die Voraussetzungen für das Spiel verloren. Führt
man Winklers Texte in den Strom der großen Literaturgeschichte mit ihren
„erlaubten“, das heißt ödipalen, Themen ein, verlieren
sie die Kraft, die sie auszeichnet. Die Motive Winklers bleiben unangenehm:
Schleim, Schmutz, Eiter, Blut. Sie stören auch einen Medienbetrieb, der
das, was ihm als Pathos erscheint, für obsolet erklärt, weil er die
Auffassung vertritt, daß Schleim, Schmutz, Eiter und Blut in der modernen
Welt nicht mehr vorkommen.
„So wies ich entschlossen eine Welt zurück, die mich zurückgewiesen
hatte“: ein Satz aus dem Tagebuch eines Diebes von Genet, den Josef Winkler
in seinem Essay über den von ihm wie ein Heiliger verehrten Autor2 zitiert
(beim Besuch an Genets Grab steckt er eine Handvoll Erde wie eine Reliquie in
die Tasche). Diese Haltung hat sich Winkler bei seinem Schreiben von Anfang
an zu eigen gemacht. Ich glaube, es ist wichtig, zu sehen, daß sie sich
auf beides bezieht, auf die Inhalte der Texte und auf ihre Wirkungsabsicht;
auf das Erzählte, Beschriebene und Erinnerte einerseits, auf die jeweils
gegenwärtige literarische Aktion andererseits. Die autobiographische, nicht
völlig frei gewählte, sondern auch durch besondere Umstände bedingte
Inversion wird bei Winkler wie bei Genet in die Verkehrungsaktivität des
Schreibens hinein verlängert. Im Friedhof der bitteren Orangen, diesem
harlekinesken Buch, formuliert Winkler das hier Besprochene auf witzige Weise:
„Andere mögen in den Himmel kommen, ich möchte in die Hölle
kommen …“3 Für das herkömmliche christliche Denken und
noch für das säkularisierte Einheitsdenken zu Beginn des 21. Jahrhunderts
ist es selbstverständlich, daß jeder nach seinem hübschen kleinen
Paradies strebt. Worin aber besteht das Vergnügen, das in der Hölle
winkt? Natürlich im Braten von Päpstebeinen und im Spielen mit deren
Knochen.
Auch bei Yukio Mishima spielt die Verkehrung eine entscheidende Rolle. Die Szene
mit dem Latrinenträger – Scheißeträger, damit klar ist,
worum es hier geht – prägt sich dem Knaben in Mishimas autobiographischem
Roman Geständnis einer Maske deshalb so stark ein, weil sie ihn erstmals
mit jenem dunklen, zweideutigen Komplex von Gefahr und Analität konfrontiert,
der das Ich übersteigt, es schwindelig macht und in Ekstase – das
heißt: außer sich – versetzt. Winkler knüpft an diese
Szene Erinnerungen an kärntnerische Jauchegruben, in denen regelmäßig
Unglücksfälle passieren, und nimmt sie zum Anlaß, den Genuß
am Makabren und Schmutzigen – das „kotverschmierte Gesicht des Mörders“
– auszuleben. Das Ekelhafte wirkt anziehend, es ist wesentlich ambivalent:
Es muß ekelhaft bleiben, darf nicht gereinigt, auch nicht ästhetisch
gereinigt werden, damit es seine Anziehungskraft bewahren kann. Mishima hat
eine andere Richtung als Genet eingeschlagen, er hat ausgehend von der Erfahrung
der Erniedrigung und der körperlichen Schwäche versucht, einen gewaltsamen
Durchbruch auf die andere Seite, ins andere Extrem zu schaffen, das heißt
seine Schwäche zu überwinden, um besonders stark und überlegen
zu werden. Diesen Durchbruch hat er geschafft, und er hat ihn ästhetisch
dokumentiert, mit filmischen und literarischen Mitteln und durch mediale Inszenierungen,
die noch seinen Tod zum Gegenstand nahmen. Von der Todesfixierung jedoch, die
Winkler mit ihm teilt, konnte er sich nicht lösen, und vielleicht wollte
er das auch nicht. Im Geständnis einer Maske entdeckt der Knabe seine Sexualität
vor Abbildungen des heiligen Sebastian, der wichtigsten Ikone der Schwulen.
Mishimas frühe Lustphantasien sind mit Tod und Gewalt verbunden, mit Grausamkeiten,
die er selbst ausübt, während er sich, im wirklichen Leben ein Schwächling,
zugleich erniedrigt fühlt. Am Ende seines Lebens, bei seinem letzten ästhetischen
Akt, ist er das Opfer (er stirbt nicht von eigener Hand, sondern durch einen
jungen Freund), seine Phantasien haben sich auf die unmittelbarste Weise gegen
ihn selbst gerichtet.
Die Konzentration auf die Verkehrungsaktivitäten bringt bei Genet und bei
Mishima einen je eigenen Ästhetizismus hervor: Wenn alle Werte umkehrbar
sind, wenn sich sogar aus Scheiße Gold machen läßt, dann stellt
sich irgendwann die Frage, von welcher Position aus man derlei Aktivitäten
überhaupt organisieren kann. Gibt es einen Wert jenseits des abendländischen
Gerümpels, das so leicht entwertbar ist? Bekanntlich scheiterte Nietzsche
an dieser Frage. Mishima und Genet besetzten die freie Position mit dem Schönen,
das bei den Umwertungsvorgängen entsteht. In Kinkakuji zerstört der
hinkende, krüppelhafte Ich-Erzähler – die autobiographischen
Bezüge sind unleugbar – den Inbegriff harmonischer Schönheit,
nämlich den goldenen Tempel, in dem er als junger Mönch lebt. In diesem
Akt erfüllt sich ein primitiver Rachewunsch auf dem Weg der Sublimation,
insofern die Zerstörung durch das Feuer als letzte Überbietung des
Schönen erscheint. Die Unterwanderung ethischer Gewißheiten, die
die Entfesselung solcher Logiken verhindert hatten, geht einher mit der Verselbständigung
und Erhöhung ästhetischer Werte: ein Vorgang, der sich in Europa schon
vor der Jahrhundertwende abzeichnete, übrigens in nächster Nähe
zur Erschütterung traditioneller geschlechtlicher Konstellationen –
ich erinnere an Rilke, an Stefan George, an das androgyne Ideal in der Jugendstilmalerei.
Daß Winklers Verkehrungen einen eigenen Ästhetizismus hervorbringen,
eine ekstatische Wirkung, die aus dem Verwesenden steigt und einen Genuß
erlaubt, der von den sozialen Konflikten, die den Ausgangspunkt bilden, gleichsam
erlöst, scheint mir auf der Hand zu liegen. Mir kommt es hier darauf an,
den Zusammenhang dieses Ästhetizismus mit der sexuellen Inversion festzuhalten:
die Tatsache, daß sich Winklers einerseits so realistische – hyperrealistische,
wie gesagt wurde – Prosa in einen Kontext fügt, nicht in einen Mainstream
zwar, sondern in die alternative Gesellschaft der Manieristen und Preziösen,
der Barocken und Sprachsinnlichen, die in der allgemeinen Literaturgeschichte
eine Minderheit darstellt, wenngleich eine starke, im Verlauf des 20. Jahrhunderts
beträchtlich angewachsene Minderheit.
Wie die Beschreibungen Winklers dazu tendieren, winzige Ereigniskerne, kleine
Monaden, gleichsam Atome seiner Texte zu bilden, die keine „organische“
Erzählung ergeben, sondern nebeneinander koexistieren und sich zuweilen
aneinander reiben, neigen seine Reflexionen, die in den frühen Arbeiten
häufiger auftreten, in den späteren zurückgedrängt werden,
zum Sentenziösen, so daß man zu allen winklerspezifischen Themen
eine Reihe von Sprüchen zitieren kann, auch zum Thema des Außenseitertums.
Ich beschränke mich auf eine Sentenz, die vorzüglich in die Logik
des Verkehrens paßt: „Ich bin ein Gegner. Ich bin gegen das Gebet,
aber ich bete. Ich bin gegen die Liebe und gegen den Haß, aber ich hasse
und liebe und werde geliebt und gehaßt.“4 Wesentlich für die
Winklersche Schreibarbeit ist demnach die Gegnerschaft. Der Gegenstand von Liebe
und Gebet, Haß und Blasphemie ist nicht wesentlich, beziehungsweise: Sehr
viele Gegenstände, wenn nicht alle, kommen in Frage. Trotz der Umkehrung
wird die herrschende Praxis, die vor allem auch eine Sprech- und Schreibpraxis
ist, beibehalten: Winkler betet und liebt – mit einem Rilkeschen Wort:
Er rühmt. Die positiven Vorzeichen werden allerdings zu negativen; und
die negativen Vorzeichen, das wird allzuoft vergessen, werden zu positiven.
Die Ersten werden die Letzten sein, aber die Letzten werden auch die Ersten
sein. Der Dreck verwandelt sich in Schönheit, der Abschaum wird zum edlen
Stoff.
Trifft das auf Winklers Prosa zu? Ich bin mir nicht ganz sicher. Statt nach
Gewißheit zu streben, erinnere ich daran, daß derlei Verkehrungen
den biblischen Mitteilungen zufolge auch Christus praktizierte: Er begab sich
in die Gesellschaft von Kranken und Krüppeln, von Bettlern, Huren und Dieben
(die Schwulen, das ist wahr, fehlen in dieser Liste). Ist Josef Winkler, scheinbar
ein Mitarbeiter wie alle anderen, der heimliche Heiland der Piazza Vittorio?
Oder ihr Satan? Heutige Christen meiden zumeist den Abschaum, manche hassen
ihn, wenige riskieren die Berührung. Winkler sucht die Nähe, aber
nicht um Barmherzigkeit zu üben, sondern um den Spieß umzudrehen.
Nicht um die Schmutzigen zu reinigen, die Kranken zu heilen, die Bösen
gut zu machen, sucht er ihren Anblick, sondern um sie in ihrem Sosein mit den
Kränzen seiner Aufzeichnungen zu schmücken. Im Grunde ist das eine
versteckte, kaum je wirklich gezogene Konsequenz des Evangeliums. Die Inversion,
auf die Setzungen einer immer noch herrschenden Moral fixiert, an der sie sich
abarbeitet, erweist sich zuletzt – aber wo und wann kommt dieses Ende?
– als affirmativ.
(Ausschnitt)
[kolik ]