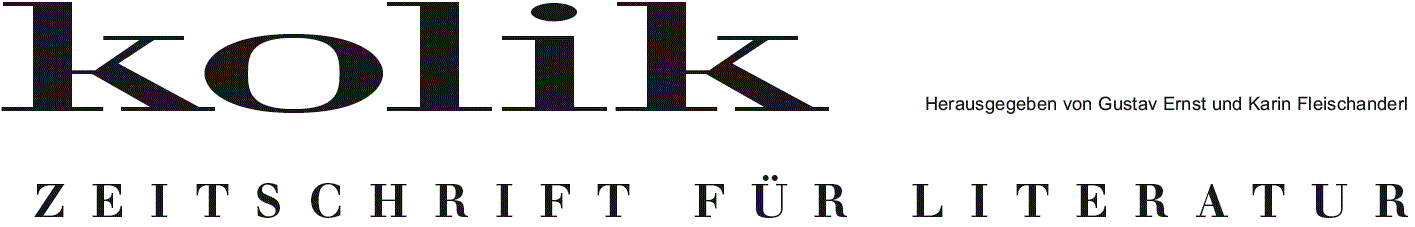Friedbert Aspetsberger
Zum Erschreckenden an den Kritikern (sehr schlecht)
Es kann in der Literatur gar nichts geben, das Literatur-Kritiker so hasserfüllt wie die sog. „jungen Popliteraten“ aus der angeblichen „Golfgeneration“ (nach spiritus rector Florian Illies). Gemeint sind, unter anderen, die Damen und Herren Benjamin von Stuckrad-Barre, Christian Kracht, Moritz von Uslar, Eckhart Nickel, Elke Naters, Joachim Bessing, Carl von Siemens, Alexander von Schönburg, Sven Lager und, wenn man z. B. die Sammelbände „Mesopotamia“ (1999, später unterbetitelt als „avant-pop-reader“) und die schwere Netzarbeit von „the Buch. leben am pool“ (2001) liest, sehr viele (sehr gute) mehr. Mehrere von ihnen haben sich vor einiger Zeit in einem bessern Berliner Hotel eine „Tristesse Royale“ bestellt und dabei fotografieren lassen. Sie zeigen auf den Fotos Ruhe in unsern aufgeregten Zeiten der Betriebswirtschaft auf jedem Gebiet, insbesondere dem der Emotionen. Die Unerregtheit wird ihnen, wie ihre Anstandskleidung (oder besser Anstaltskleidung), als Label des Gesellschaftlich-Dünkelhaften angerechnet und von jenen Kritikern nachgetragen, die vermutlich noch nie in einem sog. bessern Hotel fotografiert wurden. „Springerstiefel“ sollte Stuckrad tragen, dann wäre er enttarnt! wünscht einer. Kurz zwei drei Beispiele dieser Erregung über die Unerregtheit (die Mehrzahl der Rezensionen über diese sehr gute Literatur [sehr gut] ist allerdings sehr gut):
Reinhard Baumgart diffamiert in der ZEIT den „schamlosen Trash-Piloten Benjamin von Stuckrad-Barre“ (so bfz. in der alten NEUEN ZÜRCHER vom 2./3. 2. 2002) schamlos: Baumgarts Vermessung der Literatur (der Roman „Blackbox“ ist „ein Print-Event wohl eher als ein Buch“, „ramschig runtergedruckt“ etc.) lässt er eine physiognomische Vermessung des Autors folgen: ein „vage weiches, vage auch brutales Gesicht“, man würde Stuckrad „mit Springerstiefeln […] in dunklem Park nicht gern begegnen“, ein „diffuses Erscheinungsbild“, „sein Blick hat keinen Charakter, verrät nur das Wahrnehmungstalent, aber keine eigene Erfahrung mit der Welt“; er ist eine „auf serielle Zündung trainierte Gagmaschine“, „zum Talkshow-Blödmann reduziert“, ein „Reporter als Chamäleon“ usf. So DIE ZEIT (21. 9. 2000). – Nicht anders Katharina Döbler für Elke Naters’ Zusammenstellung „G.L.A.M.“; man könne das Buch mit einem redenden Schrank verwechseln, „in dem jede Menge modischer Statements gestapelt“ sind, freilich die flachsten, die sich auf Vorzeige-Gegenstände reduzieren lassen: „Wo Buch drauf steht, ist manchmal nur Bikini drin“ (Die Zeit, 23. 8. 2001). Am tiefsten lotet die Untiefen der Wiener STANDARD aus: auch Naters, wie Stuckrad, „sieht, ohne zu erkennen oder wenigstens zu ahnen“, sie „kann mögliche Bedeutungen nicht literarisch einarbeiten […] bei ihr sind Schlappen eben nur Schlappen“, ihr „fehlt das tradierte System vor Zeichen und Bedeutung“, sie ist „zarte 37 und kann noch immer nicht richtig Deutsch“. Weiters: „Kulisse heißt der Trick […] das Setting [z. B. Ostasien als Handlungsraum] erfüllt bei Naters keinen literarischen Zweck, ist nichts als Blendwerk“ etc. Also: „jeder kann Pop-Autor sein, jeder ohne Phantasie, ohne handwerkliches Können, ohne genügend Deutschkenntnisse, ohne … Mann oder Frau braucht nur mehr Chuzpe und PR“. Der Rezensent beteuert, er rezensiere selbstlos so negativ, damit keine Buchhändlerin „für so wenig Text heimtückisch erwürgt wird“ (nicht Patrick Bateman, sondern Gabriel Loidolt, 9. 6. 2001). Ist ungebildete Anmaßung, die sich als Bildung geben will, immer so aggressiv? Ja.
Nach Stuckrad kann das Journalisten-Dasein auch darin bestehn, sich durch kleinere moralische Erektionen kundzutun: „umrechnen auf ICH“. Das ist naturgemäß oft ein Vorgang aus Phrasen. Ein solcher Art Berufener rechnet sich folgend auf Stuckrad um: der brächte „voll fette und gigageile Reportagen“ und „frischen Wind ins Sesselfurzer-Genre“; seine Modernität sei ein „derart geiler Faktor, dass […] vom natürlich auch heftig Kulturpessimismus furzenden Sesselkleber-Genre gleich einmal vorneweg das Ende der Popliteratur ausgerufen“ werde. Stuckrad sei ein „Großmeister der Häppchenlektüre und überhaupt einer Lektüre für Menschen, die sich nicht fürs Lesen interessieren“, doch gebe „es ja viele Bubis und Mädis, die Lesen plötzlich wieder geil und fett finden“. Adresse an Stuckrad: „Tanz mir ein Buch!“ „Voll fett“ heißt in Wien, wenn ich recht unterrichtet bin, sehr betrunken (Ch. Schachinger in Der Standard, 21. 2. und 2. 3. 2002).
Ist es so?
*
Deutlich ist: Daneben, dass die Texte und das Auftreten der sog. Pop-Literaten anscheinend Erlöser- bzw. Entbindungsfunktionen übernehmen können, z. B. ein „gigageiles“, „voll fettes“, „furzendes“ und nochmals „furzendes“ Ich-Bild eines Kritikers aktualisieren, bewirken sie bei manchen anderen Rezensenten Entzugserscheinungen von dem, was die für Literatur halten und was daher ihre Sehnsucht ist, die sie rezensierend auch sein wollen. Dieser Sehnsucht gibt die anscheinend interesselose Sicherheit der Tristesse-Royale- bzw. Joie-Republicaine-Attitude keine ausreichende Nahrung. Dafür gibt es aber genug andere Literatur, erfreulicherweise. Die Literatur war nie auf sie selbe als eine festgelegt, was Kritiker doch wissen. Man kann nicht auf ihr sitzen und sie im Sitzen zurechtrücken und dann sagen, das ist kein Sesserl, sondern noch immer Literatur und bedeutet viel und was sie soll.
Weil ich Kritiker das will.
Wenn das aber so sein sollte, dann dürfen auch alle andern, zum Beispiel diese sog. Popliteraten, sagen: das sind unsere Sesserl und bedeuten viel, auch wenn wir den Kritikern Figuren aus der Medienwelt vorschreiben (incl. der Medien Buch und Theater). Denn wir haben eine Medienwelt, scheint uns, und wir hatten auch eine, als die Menschen, mit anderen Medien, in vorbürgerlicher Zeit vom Adel und von der Kirche moderiert wurden. Wir lassen die Welt, die immer medial geprägt und durchmarkiert ist, in ihrer medialen Vermitteltheit und durchmarkiert in Erscheinung treten: na „schön“! würde Schiller dazu sagen, wenn er eine Anprobe des Stuckrad-Stückes machte (so wie Bernhards „Peymann“ neben den Hosen-Proben Schiller-Proben macht).
*
Auch die inkriminierten „Kulissen“, z. B. Zentral- oder Ostasiens, sind weniger Kulissen als es die sind, die als keine gelten und aus denen der Fremdenverkehr und daher die Heimaten in Europa bestehn. Wir waren, könnten die sog. Popliteraten dazusagen, wirklich schon in Afghanistan und in Thailand und auf den Philippinen und in Deutschland und in Cambodscha und in China, wie jeder, aber wir waren wirklich dort, und das heißt: wir brauchen, weil wir sie kennen, diese Länder als Schriftsteller für die Leser nicht fremd zu schreiben, weder im Reise-Essay noch im Reise-Roman, wie ein Arzt gefälligkeitshalber einen krank schreibt, wenn der gern krank wäre. Für die Fremdheit der von der Heimat weit entfernten Länder reicht die heimatliche Selbstentfremdung, das „umrechnen auf ICH“. Aber: woher eines nehmen und nicht stehlen? Tristesse contemporaine.
In „Der gelbe Bleistift“ konturiert Kracht übrigens „die alte Welt“ im Blick aus Ostasien als „eine Art Disney- und mumifiziertes Europa, das es schon lange nicht mehr gibt, dessen Mailänder, Hamburger und Wiener Namen man sich aber noch leihen kann, obwohl das Zeug selbst wahrscheinlich hier [in Ostasien] hergestellt ist.“ Immerhin: die Ressentiments der Literatur-Kritiker sind europäisch. Bildungs-, Anmaßungs- und Anbiederungstrash.
(Auszug)
[kolik ]