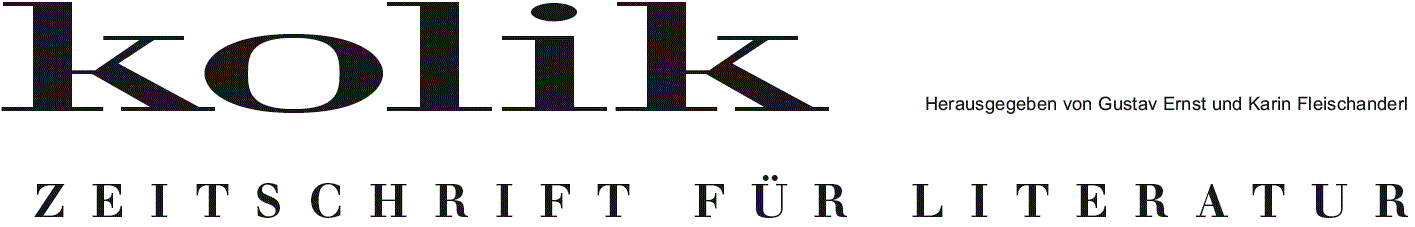Franz Schuh
Hinein in den Kanon mit ihm!
Plädoyer für das Niedrige und das Erhabene, für den Kulturkampf und für Wolf Haas
Der Kriminalroman hat in dieser merkwürdigen Dichotomisierung der Kulturproduktion eine eigene Moral. Aber was ist diese Moral des Kriminalromans? Nicht die Moral der Inhalte, der Fabeln, die man vorschnell mit der berühmten Formel festhalten könnte: „crime does not pay“, das Verbrechen zahlt sich nicht aus; vorschnell, weil dieses Prinzip, nennen wir es kurz das Prinzip der ökonomischen Defizienz von Kriminalität, zwar tatsächlich die innere Weisheitslehre der Kriminalliteratur im großen und ganzen darstellt, aber moralisch interessant ist die Kriminalliteratur nicht wegen dieser ihrer pädagogischen Gutmütigkeit, Geradlinigkeit; sondern weil sie dieses Prinzip des Eitlen und des Vergeblichen des Verbrechens diskutiert (und ihm die Eitelkeit, die Vergeblichkeit der Verbrechensbekämpfung auf lange Sicht – es gibt keinen Endsieg über das Verbrechen – entgegenstellt).
Die Kriminalliteratur setzt ihr moralisches, ihr moralisierendes Prinzip nicht einfach fest, setzt es nicht einfach durch und führt es nicht einfach kitschig zum Siege. Die Kriminalliteratur lebt von der Fragwürdigkeit solcher Prinzipien, im Namen dieser Prinzipien läßt sie selten, aber immerhin auch Ausnahmen zu, selbst Ausnahmen von der eisernen Regel, daß das Verbrechen sich nicht auszahlt. Eine Zeitlang schien es, als ob die Ausnahmen zur Regel werden könnten: Ich rede von Thomas Harris oder Andrew Vachss, in deren Büchern es nicht zuletzt um eine extreme Ästhetisierung des Verbrechens geht, um das ewige American Psycho – eine Ästhetisierung, die ja auch schon in den hochkulturellen, radikalen Avantgarden Schule gemacht hat. Aber nichts davon wurde zur Regel – schlicht weil Henning Mankell diese Tendenz überrumpelte, indem er die klassischen gesellschaftkritischen Impulse der Gattung wiederaufnahm, ohne dabei im geringsten auf die Ästhetisierung des Verbrechens zu verzichten. Aber ich will wieder zu meiner Frage zurück: Was ist die Moral des Kriminalromans? Gemeint war, wie gesagt, nicht die Moral der Inhalte der Fabel, nicht die fabelhafte Moral des „crime does not pay“; gemeint war die Moral, die überhaupt die Existenz der Gattung Kriminalroman sanktioniert und zusammenhält. Lassen wir die Moral (oder besser das Ethos der Kriminalliteratur) aus der eingebürgerten Diskrepanz von Kommerz und Kunst, von U und E resultieren, dann würde ich als Rezensent von Kriminalromanen sagen: Der Kriminalroman ist eine der seltenen Gattungen, die als Kunst kommerziell und die als Kommerz Kunst sein können.
Friedbert Aspetsberger hat sehr zu Recht darauf hingewiesen, daß die halb surreale, halb naturalistische Figur des Major Kottan nicht wenig Erkenntniswert angesichts allfälliger Staatsidiotien bietet. Wie Zenker verschont auch Haas das Staatsvolk nicht. In „Wie die Tiere“ hat Brenner, der – wie Kottan – stets ausgebrannte Detektiv, etwas Besonderes vor, und hier unter uns kann man ja ruhig darüber reden: In Österreich gibt es ein Wort, das einen besonderen, alles überstrahlenden Glanz hat; es ist das Wort „Frühpension“. Ich behaupte, daß das Ritual, mit dem man zu einer Frühpension gelangt, niemals so gut beschrieben wurde wie in diesem Tierbuch von Haas: Brenner reicht für die Frühpension ein. Er ist genau informiert über die regionalen Unterschiede. In Tirol hat man weniger Chancen als in Wien. Man darf nie im Diagnosejargon sprechen: Zum Arzt muß man sagen: „Ich hab’ Kopfweh“ – und ja nicht „Migräne“. Das auf der Zunge liegende Wort „arbeitsunfähig“ darf von seiten des Petenten auf keinen Fall fallen.
Brenner gerät an eine Chefärztin, die sehr typisch agiert. Einerseits hält sie streng Wacht an der Grenze, die den sozialversicherten Menschen eines Tages von der Arbeitswelt, wenn er sie überlebt, trennen wird. Andererseits aber ist sie sentimental und legt vor Brenner ihre Lebensbeichte ab. Brenner macht sich nicht zuletzt deshalb Hoffnungen: die Frühpension! Als er das Gebäude seines Ansuchens verläßt, hat er das Gefühl, er könnte der Welt einen Haxen ausreißen. Allein das Einreichen heilt die Schmerzen, auf die man pocht, um früh in Pension zu gehen! Genial, wie der Autor in der Folge die platonische Idee der Frühpension mit dem Rest der Handlung verknüpft.
Ohne Zweifel: Dergleichen nennt man Gesellschaftskritik. Im zitierten letzten Buch von Haas wird diese Kritik übrigens auf eine erheiternd verschlagene Weise konkret: Was den Menschen vom Tier unterscheidet, ist bekanntlich die Tierliebe. Mag ja sein, daß es Tiere gibt, die einander mögen. Aber die Tierliebe des Menschen ist ein Artenspezifikum, und natürlich ist sie auch organisiert: In „Wie die Tiere“ gibt es zum Beispiel die etwas anrüchige Gesellschaft „Treuhund. Treuhändische Erbverwaltung für Tiervermögen“. Vermacht jemand seinem Hund ein Vermögen, dann weiß er ja, der Hund selbst wird es nicht mehren. Dafür springt die „Treuhund“ ein, besonders ihr Chef Hojac, ein Anwalt, über den Wolf Haas eine Theorie des feisten Lächelns ausgießt: „… fett wird ein Gesicht vom Essen, und das ist vollkommen in Ordnung. Aber feist wird ein Gesicht vom feisten Lächeln.“ Man kann diesen Typus vor sich sehen: In Politik und Medien, in Kunst und Wirtschaft taucht das feiste Lächeln auf; es ziert die Gesichter derer, bei denen alles wie geschmiert läuft, aber doch nicht so ganz: Etwas an ihnen stimmt nicht, und solange es nicht herauskommt, lächeln sie noch feist.
(Auszug)
[kolik ]