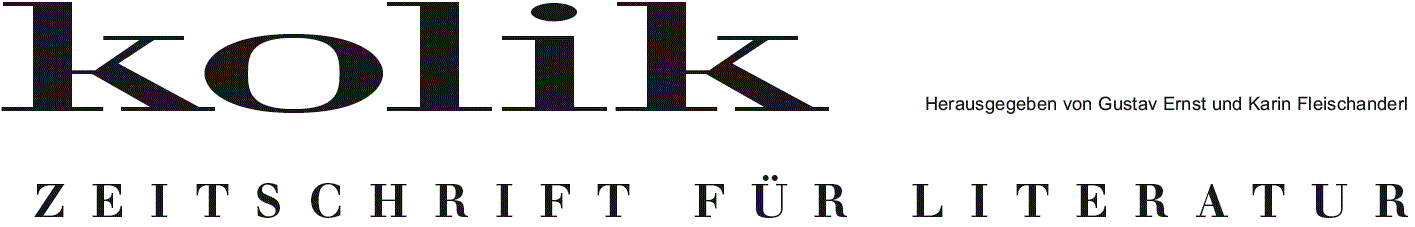Richard Obermayr
Anfänge ohne Ende
Was man nicht erfliegen kann, das muß man sich erhinken.
Zurück zu jenem Mann, der uns gestern auf einer Straße entgegenkam. Es ist, Sie haben es längst erraten, Johannes Kepler, an einem Wintertag im Jahre 1611, auf einer verschneiten Straße in der Stadt Prag. Er ist auf dem Weg zu seinem Freund und Gönner Wackher von Wackenfels, in Gedanken versunken, welche Überlegungen er ihm verehren könnte. Er will ihm, einem Mann mit mehr als gewöhnlichem Witz, von dem unter anderem immerhin eine Ode an das schlesische Bier auf uns gekommen ist, etwas widmen, vom dem er annimmt, daß es seinem Freund umso lieber und willkommener sein müßte, je mehr es dem Nichts nahekommt, wegen, wie er schreibt, „des witzigen und anmutigen Spieles halber, das man wie ein munterer Spatz damit treiben kann.“ Während er zu diesem Zweck die Elemente durchnimmt, tut er vielleicht nichts anderes, als jene Gedanken, die ich gestern einzeln in einem Bauchladen angeboten habe, wie ein wählerischer Käufer noch einmal zu prüfen, ob sie dem Geist seiner Unternehmung auch zupaß kommen.
„Mag Dir nun beim Betrachten des Nichts das Geringe oder Kleine, das Wertvolle oder Vergängliche gefallen, immer muß es schon fast ein Nichts sein. Da es in der Natur viele solche Dinge gibt, muß ich dir halt eins heraussuchen. Du denkst vielleicht an eins von Epikurs Atomen. Aber das ist wirklich ein Nichts. Gehen wir daher die Elemente durch, mit anderen Worten: das, was bei jedem das Kleinste ist.“
„Wenden wir uns … der Erde zu. Aber träume mir dabei nicht von den Schätzen meines Archimedes, der die Erde in Sandkörner zerlegte, wovon 10.000 auf ein Mohnkörnchen gehen … Außerdem kann man die Form dieser Körnchen nicht mit Augen sehen, und Archimedes verrät sie auch nicht. Es steckt in ihnen ja auch kein Sinn, es wird keine Lust nach Unerkanntem geweckt.“ Denn was ist der Grund des ästhetischen Vergnügens? Nicht doch die genaue Bestimmbarkeit, sondern die Unbestimmbarkeit und Unbeherrschbarkeit des Wirklichen. Die ästhetische Lust ist von einem Interesse am Unbekannten geleitet.
Es ist, als ob ein Leser sich hier auf die Suche nach jenem Buch der Natur macht, dessen Anfang genau jenes Maß an Unbekanntem besitzt, eine anfängliche Fremdheit, die ihn einlädt, sie in weiteren Schritten aufzulösen, in der Hoffnung, Unverständlichkeit sei bis dahin nur der Effekt einer vorläufigen, unvollständigen Rezeption. Was allzu bekannt ist, kann daher nicht dieser vielversprechende Ausgangspunkt sein auf dem unbekannten Weg zur Erfassung des Ganzen. Das Sandkorn ist unlesbar, auch für die besten Augen, ihm läßt sich kein Sinn zuschreiben, keine Überraschungen auf dem Weg näherer Untersuchung. So ahnen wir, will Kepler im Ausschlußverfahren jenes gewünschte Objekt seines Interesses finden, das nun, nach der ersten Station, wohl zumindest genau jenes Gran an Unverständlichkeit besitzen sollte, um es sich nach und nach mit dem Verstand zu eigen zu machen und nachzuweisen, wie sich das einzelne Teil zu einem geahnten Ganzen verhält, so wie man von ersten, unverständlichen Worten annimmt, ihr Sinn würde sich im Laufe der Lektüre, und sei es erst mit dem Ende, erschließen. Gerade die Komplikationen mögen eine Aufforderung sein, wie es Kepler sagen würde, zu immer tieferem Nachdenken, als handelte es sich bloß um einen Aufschub der Verständlichkeit, die nach hinreichend vielen Informationen und Ordnungsvorgängen erreicht werden kann. Allerdings: Ist Unverständlichkeit alleine ein Privileg des Anfangs?
„Die Fünkchen des Feuers zweitens sind winzig und auch vergänglich, doch sind sie nie kleiner als die Splitter des Feuersteins, die beim Schlag abspringen.“ Ein Funke, ein erhellender Einfall, der nur kurz aufleuchtet, gibt nur kurze, schnelle Winke, aufgeregt wie die fiebernd zappelnden Beinchen eines auf dem Rücken liegenden Käfers, aber was hilft ein Einfall, ein Blitz der Erkenntnis, wenn ein Blitz die Nacht durchzuckt? Ich denke, es gilt, was Hamann in Über den Styl sagte: „nichts (ist) dem Licht, das eine Masse ausmachen und sich gleichförmig in einer ganzen Schrift verbreiten muß, so entgegen als jene Funken, welche man mit Gewalt durch den Gegensatz der Wörter herauslockt, und die nur auf einige Augenblicke blenden, um uns hernach die Finsterniß zu überlassen. Solche Gedanken schimmern bloß durch den Widerspruch einer einzigen Ecke an einem Gegenstande, dessen übrige Seiten alle im Schatten verschwinden.“ Die Einzelheit verdunkelt das Ganze und wächst auf seine Kosten, der Versuch, den Wert des Textes am augenblicklichen Erlebnis zu messen, belastet sich durch die Leichtigkeit, mit der er den Zumutungen des Scheiterns entgeht. „Nur was punktuell ist“, schreibt Lars Gustafsson, „kann allen Zerrreißproben, Verwerfungen und Zerteilungen der Fläche entgehen“, und das wäre doch, wie ich hinzufügen möchte, ein seltsamer Ort des Rückzugs für jemanden, der diesen winzigen Punkt erst begreifen kann, wenn er weiß, von welcher Fläche dieser Punkt ein Element ist. Ein ständiges Licht soll auf diesen Dingen liegen, denn die Beschreibung eines Phänomens kann nicht bei der Beobachtung einer Einzelheit aufhören, sondern will eine diesem Vorgang übergeordnete Regel oder eine allgemeine Struktur finden.
„Wind und Dunst könnte ich dir bieten, aber diese sind käuflich, nicht nur in isländischen Schläuchen, sondern sogar auf Papier und in Worten, überall in der Welt. Daher ist der blaue Dunst eine sehr kostbare Sache und für mich viel zu teuer. Und weil rauh und formlos, ist er auch dem Geist nicht angemessen.“ Der Dunst, Wind und Wolken, sie eignen sich nicht als Gegenstand der Darstellung. Was ihre Angemessenheit für das schöpferische Vermögen anbelangt, so mag es ihnen an nichts fehlen, ja, sie erscheinen als die reine Möglichkeit, als die bloße Vorstellung von einer Sache, die ihren vollen begrifflichen Umfang nur in der Imagination behält, in einem gestaltlosen und regellosen Beginn, der sich jeder synthetisierenden Absicht entzieht, aber keine schöne Verwirrung der Phantasie erzeugt, wie es Schlegel ausdrückt, jene obscuritas, die als Einladung verstanden werden könnte, das Unbegriffene, Unverständliche zu erhellen. Wolken dürfen wohl als etwas asymmetrischer Gegenbegriff zu der in barocker Emblematik als Symbol für Klarheit und Vernünftigkeit gebrauchten Sonne gelten, als Dunkelheit, die sich vorübergehend vor das schiebt, dem das eigentliche Interesse gilt, sind aber selbst, wie der Dunst, lange als Symptom einer Krankheit, versehen mit den Attributen des Aufgeschwollenseins, niemals selbst Gegenstand der Untersuchung. In Poetiken wie auch Polemiken werden sie als Paradigma jener Metaphorik angeprangert, die zu vermeiden sei, als Schwulst, als Rätselhaftigkeit. Die Winde sind das Nichts, das sich verflüchtigt, ehe man sie zu fassen bekommt, die Winde, die in isländischen Schläuchen zu kaufen sind, wie in der Odyssee, da Aeolos dem Odysseus und seinen Gefährten einen Schlauch aus Stierfell schenkt, in dem alle ihnen widrigen Winde gebannt sind: Sie sind immer nur Mittel, um mit dem Schiff dorthin aufzubrechen, wo einen das Unbekannte erwartet. Ist man aber so unklug und richtet seine Neugier auf sie selbst, wie die Gefährten, als Odysseus schläft, nun, dann werfen einen die Winde dorthin zurück, wo man herkommt, in diesem Fall zu den äolischen Inseln.
War zuvor nicht die Lust an Unerkanntem geweckt, bei der Betrachtung der Sandkörner, so mag die Erfahrung von Dunst oder Wind zwar sinnlich verfolgt, aber nicht kognitiv erfaßt werden. „Und weil rauh und formlos, ist er auch dem Geist nicht angemessen.“ (Die Wahrnehmung überschreitet hier die Grenzen des erkennenden Bewußtseins, die Intensität der Wahrnehmung und des Wissens divergieren in einem zu großen Maße.)
„Zum Wasser müssen wir schon hinabsteigen. Den Tropfen, der am Kruge hängenbleibt, halten hochheilige Sänger für etwas sehr Verächtliches. Und unsere deutschen Landsleute schätzen nichts geringer als den letzten Tropfen, der nach der Leerung des Bechers auf den Fingernagel gegossen werden kann. Wenn ich dir diesen Tropfen anbieten wollte, dann gäbe ich dir wahrhaftig weniger als jener Perser seinem König, der ihm mit der hohlen Hand das klare Wasser des Chaospes reichte.“ Selbst mit Wehmut begabt, kann sich jenes Nichts zur Darstellung nicht eignen, das die Leere ist, die auf eine erinnerte Fülle folgt, das Ende eines rauschenden Festes, dessen Verlauf man aus dem letzten Tropfen Wein extrapolieren sollte. Nein, in den bodenlosen Grund der Vergangenheit soll dieses Nichts nicht fallen. „Zieht ins Feld der Großkönig der Perser, so ist er wohl ausgerüstet mit Kornvorräten der Heimat und Viehherden; sogar Wasser wird mitgeführt aus dem Chaospes, einem Flusse, der an Susa vorbeifließt. Wohin er auch ziehen mag, überall folgt ihm dann allerdings eine Menge vierrädriger Maultierwagen, die das Chaospeswasser, und zwar unabgekocht, in silbernen Gefäßen nachbringen“, wie Herodot in den Historien berichtet. Man meint die Prozession der Vergangenheit selbst zu sehen, die sich aus der Quelle ihrer eigenen Erinnerungen nährt, und niemals weiter gelangt als bis zur Melancholie. And nothing ever looks emptier than an empty swimming-pool, heißt es in R. Chandlers The Long Goodbye.
[kolik ]