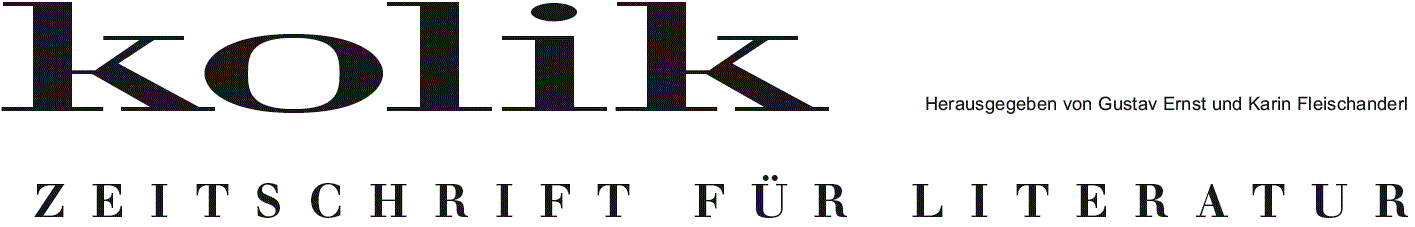Lutz Seiler
„Und unter den Füßen liegen die Vergangenheiten …“
I
„Daß Sie trotz Champions League heute abend zu uns gekommen sind …“ – so oder ähnlich setzt nicht selten der Prolog zu
Gedichtlesungen ein, trotz Fußball, trotz des Weges, trotz des schlechten Wetters usw., bis die Leute,
die da sitzen, schon bevor sie nur einen einzigen Vers vernommen haben, sich tatsächlich fragen müssen,
weshalb sie eigentlich am Platze sind und ob das überhaupt noch angemessen ist.
Ein geheimes Unvertrauen in den Eigenwert des Gedichts scheint auch Liebhaber und professionelle Kennerschaft
zu betreffen. Der vielleicht nur gut gemeinte Psalm über Nichtachtung und mangelnde Wertschätzung, mit dem heute in
der Regel das Gespräch oder der Text über Gedichte angestimmt wird, bestätigt vor allem, daß es offenbar keinen vernünftigen
Grund gibt, Gedichte zu schreiben. Dagegen einige vernünftige Gründe, es nicht zu tun. „Honoraraussicht ist es nicht,
viele verhungern darüber“, schreibt Gottfried Benn in seinem Gedicht über den „Satzbau“, und auch daran hat sich sicher nichts geändert.
Man kann annehmen, daß sich das Schreiben von Gedichten mit einer gewissen Unbedingtheit durchsetzt. Seine
Ursache wurzelt nicht in irgendeiner begünstigenden Konstellation des gesellschaftlichen Lebens, nicht im Gespräch
über das Gedicht und schon gar nicht in poetologischen Grundsatzerklärungen. Sein Antrieb geht all dem voraus und
bleibt im Grunde unsichtbar. Auch in theoretischen Diskussionen und in Fragestellungen, wie sie Poetologien auswerfen –
ob von Literaturexperten oder von den theorieinteressierten unter den Dichtern selbst hervorgebracht –, bleibt jenes
präpoetologische Warum und Woher seltsam unberührt.
In einem Vortrag mit dem Titel „Poesie und Leben“ schrieb Hugo von Hofmannsthal: „… und unter den Füßen liegen die Vergangenheiten,
in durchsichtigen Abgründen gelagert wie Gefangene. Und von der Dichtung der Gegenwart zu sprechen, gibt es mehrere falsche Arten,
die gefällig sind. Und Sie [das Publikum, L. S.] besonders sind ja so gewohnt, über die Künste reden zu hören. Unglaublich viele
Schlagworte und Eigennamen haben Sie in Ihrem Gedächtnis, und alle sagen Ihnen etwas. Ich müßte Ihnen allerdings verschweigen,
daß mir die meisten Namen nichts, rein gar nichts sagen; daß mich von dem, was mit diesen Namen unterzeichnet wird, auch nicht
der geringste Teil irgendwie befriedigt. Ich müßte Ihnen verschweigen, daß ich ernsthaft erkannt zu haben glaube, daß man über
die Künste überhaupt fast gar nicht reden soll, fast gar nicht reden kann, daß es nur das Unwesentliche und Wertlose an den
Künsten ist, was sich der Beredung nicht durch sein stummes Wesen ganz von selber entzieht …“ Damit könnte man enden, aber
auch Hofmannsthal endet damit nicht. Seine Rede kommt zustande und auf ihre Länge, indem der verborgene Anspruch, etwas
Gefälliges zu machen, dem erwünschten Brückenschlag zwischen Dichter und Publikum mit ein paar geistreichen, verblüffenden,
neuartigen Wendungen statt zu geben, ausführlicher zurückgewiesen wird.
Diese Haltung ist seit Beginn der Moderne erprobt. In der Verweigerungs-Geste steckt ein Hinweis auf den alles umfassenden und
nicht paraphrasierbaren Zusammenhang von Text und Leben in der Existenz des Autors. So notwendig dieser Zusammenhang wirkt, so
unsichtbar bleibt sein Gewebe, seine Binnenstruktur für den Leser. Diese „Unklarheit“ zwischen Autor und Leser kann nicht
überbrückt werden, deshalb ist sie produktiv. Jeder schreibt aus dem eigenen Kontext Bedeutungen zu, Kommentare entstehen,
Poetiken, Kritik, der Leser daheim, jeder versteht etwas, wenn er will, aus dem eigenen Zusammenhang heraus. Und nicht
selten wird sich der Autor – teils aus Bequemlichkeit, Eitelkeit und Unverstand, teils aber auch in jener sich immer wieder
neu reproduzierenden Erklärungs-Not – selbst an dem orientieren, was andere verstanden haben beim Lesen seiner Texte, wenn er
dazu angehalten ist, sein Schreiben zu kommentieren. Doch die „Unklarheit“, der Abstand, die Differenz, bleibt, auch wenn der
Autor gelobt wird. Wird er kritisiert, wird sie vielleicht schmerzhafter empfunden, aber nicht mit jenem Gefühl der Enttäuschung,
wie sie einem Mißverständniss folgen kann. Denn Verständnis konnte in dieser Beziehung nicht vorausgesetzt werden. Eine Situation,
die im einzelnen eher selten gute, selbstvergewissernde Aspekte hat. Aber das gilt es auszuhalten im Umgang mit dem Gedicht –
für beide Seiten.
„Trotz Champions League“: Offenbarte die flotte Eingangsbemerkung unseres Veranstalters (siehe oben) oder der Psalm von der
Marginalisierung, der bösen Nichtbeachtung des Gedichts nur eine gewisse Hilflosigkeit – geschenkt. Doch die Verlegenheit ist
grundsätzlich. Das Ganze entspringt einer grundsätzlichen Verlegenheit vor der Unbedingtheit des Gedichts, die doch zugleich
seinen hermetischen Charakter begründet. Wer das nicht mitdenkt – eine seltsame Leere breitet sich augenblicklich aus zwischen
diesem und dem Gedicht, eine allzu verbissene Suche nach Brückenschlägen setzt ein, und schließlich folgt der rasche
Griff zur Floskel: „trotz Champions League“. Dazu tritt – vielleicht seltener – eine verborgene Abneigung gegen das sperrige,
schwer rubrizierbare Wesen des Gedichts. Richtet sich dieses (und damit sein Autor) nicht bereits von seinem Wesen her gegen
den Literaturvermittler, was ist es, daß es ihm seine Arbeit derart erschwert? Was diese Frage, bewußt oder unbewußt gestellt,
schließlich im einzelnen auslösen kann – gut vorstellbar.
Die abenteuerlichsten Projektionen begleiten die Existenz des Dichters, seit er seine alten Bestimmungen als Rhapsode, Minnesänger
oder Hofschreiber verloren hat. Das muß ihn nicht kümmern, trotz Champions League. Mich traf es in diesem Fall, und jeden anderen
hätte es auch getroffen, der wie ich jeden Dienstag noch Fußball spielt, dessen Kindheit zu 90 Prozent aus Fußball bestand, der
bis heute an jedem Spieltag sagen kann, wo der 1. FC Köln in der Tabelle steht und sich plötzlich innerhalb der falschen, aber
implizierten Alternative „Lyrik oder Champions League“ in die Rolle des Spielverderbers manövriert sieht. Plötzlich ist er es,
der nicht nur die Gedichte schreibt, nein, der zu allem Überfluß auch noch die ihm selbst völlig fremde Gegenseite der miesepetrigen
und selbstgefälligen Fußballverächter, die schon im Eingangssatz des Veranstalters ihre geistige Überlegenheit zur Zufriedenheit
ausgedrückt fanden, bedienen soll.
[kolik ]