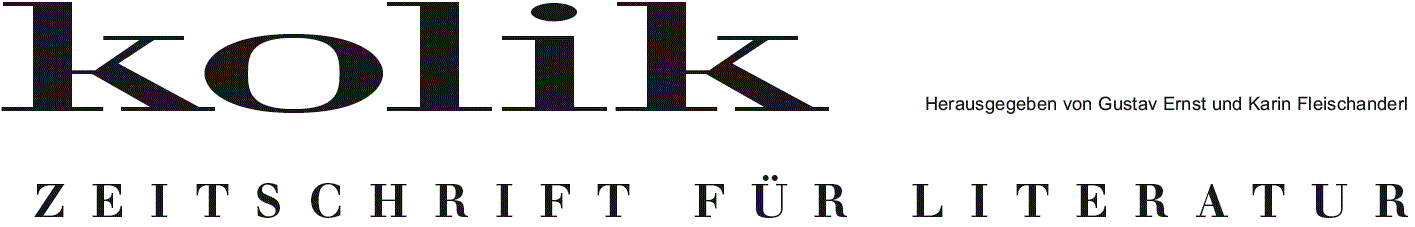Kathrin Schmidt
FRAKTURSPRACHE/SPERRSCHRIFT:
Von Körperläsionen zu Wortbrüchen
Poesie führt nicht die Existenz der Schaumgeborenen. Ihre Zeugung braucht
aber auch nicht die Verschmelzung zweier Geschlechtszellen. Eher schon käme
eine Art der Vermehrung in Frage, wie sie dem Bandwurm eignet: Ein Stück
verselbständigt sich, wird unter Umständen ausgerissen wie ein Fliegenbein,
womöglich in übler Absicht, und vervollständigt sich Wort für
Wort zu einem wiederum vollständigen Textkörper, dessen Existenz an
unvorhersehbarer Stelle unmotiviert vorkommen mag. Zum Beispiel geschieht es
ja doch, daß auf die Frage „Liebst du mich wirklich?“ der Befragte
folgendermaßen antwortet:
Niemand mehr zu sehen doch den Vogel spürt man
den Boden haben die Wörter zerkratzt es schneit drauf
ich sollte vorsichtiger sein zur bevorstehenden Hochzeit
Weisheiten um die Stirn mir binden
so ein Pilzbefall besser ich geh
denn der Himmel schimmelt zu
läßt mich mit dem Mund im Schnee im Schnee
Gellu Naum, Niemand mehr zu sehen,
aus: Rede auf dem Bahndamm an die Steine, S. 219
Ist das nun eine richtige Antwort? Oder schmarotzt Poesie in geeigneten Wirten?
Es gibt genügend Leute, die diese Frage mit einem lauten JA beantworten
würden. Ich kenne einige davon. Mit ihnen sehe ich mir hin und wieder –
und mit durchaus meßbarem Vergnügen – eine Sportsendung an.
Da ich die Frage nach dem vermeintlichen Schmarotzertum der Poesie während
des Hundertmeterlaufes nicht stelle, wird sie mir nicht beantwortet – und
zwischenmenschliche Konflikte auf diesem Gebiet bleiben weitgehend aus. Ich
halte diese Auseinandersetzung nicht für nötig, denn Poesie ist ebensowenig,
wie sie ein Verein ist oder ein Bandwurm, ein kostbares Gut, das es zu verteidigen
und zu verbreiten gilt. Sie weiß, was sie (wert) ist, und sie geht ihren
Weg. Da sie, wie bemerkt, kein Verein ist, braucht sie keinen Vorstand, keinen
Schatzmeister, keinen Protokollanten. Ver(s)sammlungen hält sie unregelmäßig
und selbstverständlich ohne Beachtung der Vorschriften des Vereinsregisters
ab. Es ist nicht nötig, eine Mitgliedschaft zu beurkunden. Dafür bin
ich sehr dankbar.
* * *
Das Verbrennen eines Gedichtbandes, das Verrauschen einer gesprochenen Strophe
im Lärmpegel von Küchengeräuschen, das Erlöschen eines Versbildes
auf der Netzhaut im Weiterwandern der Augen sind physikalisch beschreibbare
Vorgänge. Die poetische Substanz hingegen scheint gegenüber Zerstörungsprozessen
immun, als durchziehe sie die Jahrhunderte wie ein weitergereichtes Pfand, das
hin und wieder jemanden dazu verleiten kann, es auslösen zu wollen …
Sie sehen: Meine Vorstellungen einer Poetik sind die eines in literaturverwaltender
Wissenschaft wissentlich unwissend sich haltenden Menschen. Weil in der Vergangenheit
alle Versuche, mit einer von außen herstammenden Systematik einen Haltepunkt
am Zirkushimmel der Kriterienbeliebigkeit zu verankern, mir also einen schönen
Dreh- und Angelpunkt für meine eigene poetische Trapezarbeit zu verschaffen,
im Mustopf der Selbstzensur endeten. Nichts war mehr möglich, hatte ich
einmal ein Wort für einen Wert gewagt, den ich in der Poesie entdeckt zu
haben glaubte – das Druckschwarz gelierte, ehe es aufs Papier kam, schon
in meinem Kopf. Diese Enthaltsamkeit hinsichtlich theoretischer Reflexion setzt
den, der sich ihrer bedient, um selbst schreiben zu können, dem Verdacht
der Koketterie aus, denn, natürlich: Poetische Arbeit ist nicht möglich
ohne Kenntnis poetischer Arbeitsweisen, ohne also Bücher über Bücher
gelesen, Gespräche über Gespräche geführt zu haben mit anderen
Poesiearbeitern, über den Schreibtisch, die Bücherkippe im Arbeitszimmer
oder die Jahrhundertwenden hinweg. All das tue ich gern und oft und mit absolut
zu nennender Notwendigkeit. Was ich indes nicht kann und inzwischen auch nicht
mehr versuche: eins mit dem und gegen das andere zu verorten, mir Klarheit zu
verschaffen und dieser den Rahmen eines nach logischen Gesichtspunkten gebauten
Klartextes zu geben. Solcherart Unfähigkeit macht einen wesentlichen Teil
meiner Arbeitsweise aus, die ich in diesem Sinne eine naive nennen möchte.
Ein zweiter wesentlicher Teil meiner Arbeitsweise wird von der Sehnsucht bestimmt,
eben doch Klartext reden/schreiben zu können. Mich selbst und mein Bild
von mir ad absurdum zu führen. Nicht naiv bleiben zu müssen. Mit der
einen Voraussetzung meines Schreibens die andere zu verfolgen. Sie zu erledigen.
Ein wenig mutet es an wie die Jagd der unerfahrenen Katze nach dem eigenen Schwanz.
Was bei dieser Jagd aus dem Leib tritt, ist glücklicherweise nicht Blut.
Ein solcherart zwischen zwei Zwänge gepackter SchreibLeib ist von sich
aus in steter Spannung.
Darin kann ich ein Lied singen/einen Vers sagen.
Mir etwas vormachen. Ihnen etwas vormachen.
Mich auf Vorgänger und Nachfolger beziehen, durchrechnen.
Mir einen Ort geben, was nicht meine Aufgabe sein kann.
Beim Schreiben sehe ich von meinem Körper nur die über die Tastatur
springenden Finger und ein Stück von Bauch und Beinen, weil ich nicht sehr
gerade in meinem Stuhl sitze. Manchmal, während einer besonders intensiven
Art des Nachdenkens, schürze ich die Lippen, und dann sehe ich meinen vorgeschobenen
Mund. Vermutlich schiele ich dabei. Zum Glück muß ich mich nicht
mit ansehen.
(Auszug)
[kolik ]